Biologische Wesen
|
|
Biologie aus quantenmechanischer Sicht
Über Biophotonen
|
|
Geschichte der Erde und des biologischen Lebens
|
Beitrag 0-26
Wie effektiv ist die moderne Schulmedizin?
Wie effektiv ist die moderne Schulmedizin?
Diese Frage zu beantworten, hilft die Lektüre folgender Artikel:
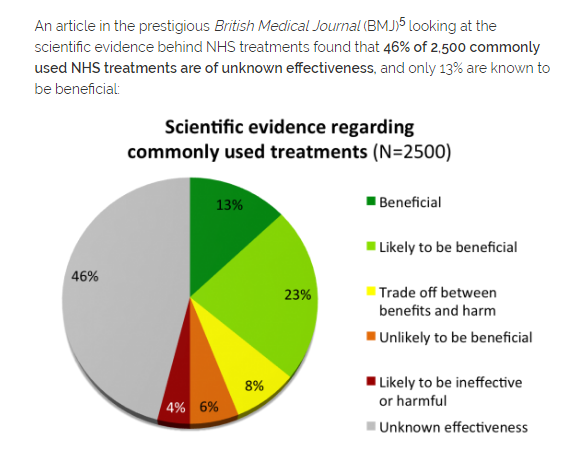
Zahlen zur Wirksamkeit der Schulmedizin in Großbritannien
Bei Rückenschmerzen etwa sind Placebos empfehlenswerter
Quelle: Werner Bartens: Hilft wenig, schadet viel: Schmerzmittel bei Rückenschmerzen, SZ vom 3.3.2017, S. 14.
Diese Frage zu beantworten, hilft die Lektüre folgender Artikel:
- The Mythology Of Science-Based Medicine
- Antidepressiva wirken kaum besser als Placebos (haben aber of unangenehme Nebenwirkungen)
- Viel zu viele unnötige Operationen
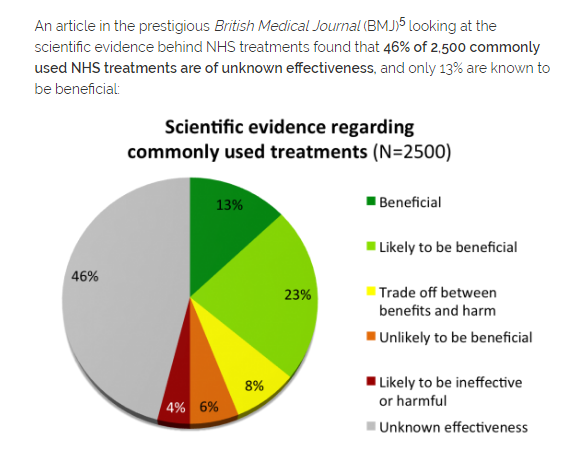
Zahlen zur Wirksamkeit der Schulmedizin in Großbritannien
Werner Bartens, Arzt & Wissenschaftsjournalist (2017):
2016 hat ein Team um Gustavo Machadeo Daten aus 35 Studien mit insgesamt über 6000 Patienten mit Rückenschmerzen analysiert.
Dabei zeigte sich, dass Schmerzmittel aus der großen Gruppe der nichtsteriodalen Antiphlogistika (NSAID) — Verkaufsschlager wie Ibuprofen, Diclofenac, Metamizol und Acetylsalicylsäure zählen dazu — die Schmerzen nur wenig, und nie lange mindern konnten: Die Wirkung der Mittel war vergleichbar mit der von Placebos.
Im Vergleich zu Placebos handelt man sich mit Medikamenten dieser Art aber ganz erhebliche Risiken ein:
Wie die Analyse der Daten gezeigt hat, waren Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu bedrohlichen Blutungen bei Patienten, die das Medikament genommen hatten, 2.5 Mal häufiger als bei denen, die — natürlich ohne es zu wissen — ein Placebo bekamen.
Beitrag 0-271
Je mehr man davon überzeugt ist, dass Heilung eintreten wird, desto eher ergibt sie sich
Welch heilende Wirkung feste Überzeugung haben kann
z.B. — aber nicht nur — als Placeboeffekt
In der FAZ vom 12.2.2017 findet sich ein Interview, bei dem es darum geht, dass ab März 2017 auch Cannabis für Schwerkranke auf Rezept erhältlich sein wird.
Befragt wurde Michal Popp, Inhaber und Geschäftsführer des Arzneimittelherstellers Bionorica aus Neumarkt in der Oberpfalz. Sein Unternehmen ist Deutschlands größter Cannabis-Produzent.
Wir sehen also:
Weiterer Beweis der Wirksamkeit fester, positiver Überzeugung ist
Simonton's Methode der Vorstellungstechniken:
In den 70-er Jahren war ein 61 Jahre alter Mann — nennen wir ihn Frank — an einer Variante von Halskrebs erkrankt, die fast immer tödlich verläuft. Als seine Ärzte ihn schon fast aufgegeben hatten — sein Gewicht war von 59 auf 44 kg zurückgegangen, er hatte Atembeschwerden und war schon so schwach, dass er kaum noch Speichel abschlucken konnte, zog man den Strahlenonkologen Carl Simonton hinzu. Simonton versicherte dem Patienten, dass jetzt nur noch er selbst den Verlauf seiner Krankheit beeinflussen könne. Hierzu brachte er dem todkranken Frank eine Reihe von Entspannungs- und Bildvorstellungsübungen bei, die Simonton und seine Kollegen am Cancer Counseling and Research Center in Dallas, Texas, entwickelt hatten.
Dreimal am Tag, so Simonton's Rat, solle Frank sich möglichst intensiv vorstellen, dass die Bestrahlung, die er erhielt, aus Millionen winziger Energiekügelchen bestünde, die seine Krebszellen bombardierten, so dass die von seinem Immunsystem ausgesandten weißen Blutkörperchen wie ein Heer römischer Soldaten über sie herfallen, sie abschlachten und die dann schließlich toten und sterbenden Krebszellen hin zu Leber und Niere schleppen konnten, damit sie von diesen beiden Organen aus dem Körper herausgeschwemmt würden.
Die Ergebnisse waren frappierend und überstiegen bei weitem die Behandlungserfolge, die sich in solchen Fällen bei einer reinen Strahlungstherapie einstellen: Frank blieb von den üblichen negativen Nebenwirkungen der Strahlentherapie — Schädigungen der Haut und der Schleimhäute — weitgehend verschont. Er gewann Kraft, sein früheres Gewicht stellte sich wieder ein, und nach nur 2 Monaten waren sämtliche Krebssymptome verschwunden.
Simonton war überzeugt, dass diese erstaunliche Genesung ohne die täglich durchgeführen Bildvorstellungsübungen nicht eingetreten wäre.
In einer Anschluss-Studie unterwiesen Simonton und seine Kollegen 159 Krebspatienten, die als unheilbar galten, in diesen Vorstellungstechniken — mit einem durchaus beeindruckenden Resultat:
Quelle: Stephanie Matthews-Simonton, Carl Simonton und James L. Creighton: Getting well again (New York: Bantam Books, 1980), S. 6-12.
Simonton hat noch eine Reihe ähnlicher Studien durchgeführt, stets mit positiven Resultaten.
Obgleich sein Verfahren umstritten blieb, fanden einige Forscher seine Versuchsergebnisse so überzeugend, dass er das Simonton Cancer Center aufbauen konnte, ein erfolgreiches Forschungs- und Behandlungszentrum in Pacific Palisades, Kalifornien, in dem Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen seine Bildvorstellungstechnik erlernen. Wie eine Bestandsaufnahme 1988 gezeigt hat, galt sie damals als die vierthäufigste a l t e r n a t i v e Krebsbehandlungsmethode.
Quelle: Jeanne Achterberg: Mind and Medicine: The Role of Imaginary in Healing, ASPR Newsletter 14, Juni 1988, Seite 20.
Heute wird seine Methode der Bildvorstellungstechniken nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Japan von aufgeschlossenen Ärzten angewandt, um die mit etablierten Therapien angestrebten Heilerfolge zu beschleunigen und nachhaltiger zu machen.
Wer Übungsanleitungen dazu sucht, findet sie z.B. in Jeanne Achterberg: Die heilende Kraft der Imagination, 1990.
In Deutschland werden auch Seminare dazu angeboten.
z.B. — aber nicht nur — als Placeboeffekt
In der FAZ vom 12.2.2017 findet sich ein Interview, bei dem es darum geht, dass ab März 2017 auch Cannabis für Schwerkranke auf Rezept erhältlich sein wird.
Befragt wurde Michal Popp, Inhaber und Geschäftsführer des Arzneimittelherstellers Bionorica aus Neumarkt in der Oberpfalz. Sein Unternehmen ist Deutschlands größter Cannabis-Produzent.
M. Popp (2017):
Unsere Gewächshäuser stehen in Österreich, wo wir eine Vereinbarung mit der zuständigen Behörde haben.
Die Anbaufläche messen wir nicht in Hektar, sondern in Quadratmetern. Mehr ist nicht nötig, denn der Wirkstoff, um den es geht, ist hochaktiv: Eige Tagesdos liegt zwischen 10 und 20 Milligramm, doch schon aus einiger einzigen Blüte gewinnen wir ein paar Gramm davon. Und wir ernten mehrmals im Jahr.
Alle anderen Heilpflanzen, die wir anbauen, wachsen unter freiem Himmel. Für Cannabis aber halten wir im Gewächshaus Luftfeuchtigkeit, Bewässerung, Temperatur und Lichtintensität ständig auf optimalem Niveau.
Während wir von allen anderen Heilpflanzen den gesamten Extrakt nutzen, holen wir aus Cannabis gezielt nur den einen Wirkstoff heraus — mit einer reinheit von 99 Prozent. Das ist Hightech.
Nun aber zur Wirksamkeit:
Dass Dronabinol [der Wirkstoff in Cannabis] gegen Übelkeit wirkt, den Appedtit anregt und beispielsweise Patienten mit multipler Sklerose hilft, ist eindeutig bewiesen.
In anderen Fällen ist es schwierig, den Beweis seiner Wirksamkeit zu führen, da der Placeboeffekt in den Patientenstudien mit Cannabis besonders stark auftritt:
Man bildet in solchen Studien ja immer zwei Gruppen. Die eine bekommt den Wirkstoff, die andere aber nicht — wobei die Leute aber nicht wissen, zu welcher Gruppe sie gehören. Nun sehen wir in den Versuchen mit Cannabis, dass hier ganz besonders viele Kranke, die den Wirkstoff nicht bekommen, von deutlicher Verbesserung ihres Leidens berichten.
Der Grund hierfür: Die Leute sehnen sich nach dem Stoff, weil sie ihn oft als ihre letzte Chance auf eine Linderung ihrer Leiden sehen. Deswegen fühlen sie sich schon besser, wenn sie bloß glauben, endlich damit behandelt zu werden. Es geht bei Cannabis ja immer um schon austherapierte Patienten, d.h. um solche, denen sonst nichts mehr hilft. Nur für sie kommt laut Gesetz Cannabis in Frage.
Das führt dazu, dass in einigen Studien der Unterschied zwischen den Patienten, die das echte Präparat erhalten und denen, die nur mit einem Placebo ohne Wirkstoff behandelt werden, nicht so deutlich ist.
Wir sehen also:
- Die heilende Wirkung der Überzeugung der Patienten, gesund zu werden, kann fast so groß sein wie die Wirkung des echten Arzneimittels.
- Und nicht nur das: Wo beides zusammenkommt, wird die Wirkung beider Einflüsse sich summieren.
Weiterer Beweis der Wirksamkeit fester, positiver Überzeugung ist
In den 70-er Jahren war ein 61 Jahre alter Mann — nennen wir ihn Frank — an einer Variante von Halskrebs erkrankt, die fast immer tödlich verläuft. Als seine Ärzte ihn schon fast aufgegeben hatten — sein Gewicht war von 59 auf 44 kg zurückgegangen, er hatte Atembeschwerden und war schon so schwach, dass er kaum noch Speichel abschlucken konnte, zog man den Strahlenonkologen Carl Simonton hinzu. Simonton versicherte dem Patienten, dass jetzt nur noch er selbst den Verlauf seiner Krankheit beeinflussen könne. Hierzu brachte er dem todkranken Frank eine Reihe von Entspannungs- und Bildvorstellungsübungen bei, die Simonton und seine Kollegen am Cancer Counseling and Research Center in Dallas, Texas, entwickelt hatten.
Dreimal am Tag, so Simonton's Rat, solle Frank sich möglichst intensiv vorstellen, dass die Bestrahlung, die er erhielt, aus Millionen winziger Energiekügelchen bestünde, die seine Krebszellen bombardierten, so dass die von seinem Immunsystem ausgesandten weißen Blutkörperchen wie ein Heer römischer Soldaten über sie herfallen, sie abschlachten und die dann schließlich toten und sterbenden Krebszellen hin zu Leber und Niere schleppen konnten, damit sie von diesen beiden Organen aus dem Körper herausgeschwemmt würden.
Die Ergebnisse waren frappierend und überstiegen bei weitem die Behandlungserfolge, die sich in solchen Fällen bei einer reinen Strahlungstherapie einstellen: Frank blieb von den üblichen negativen Nebenwirkungen der Strahlentherapie — Schädigungen der Haut und der Schleimhäute — weitgehend verschont. Er gewann Kraft, sein früheres Gewicht stellte sich wieder ein, und nach nur 2 Monaten waren sämtliche Krebssymptome verschwunden.
Simonton war überzeugt, dass diese erstaunliche Genesung ohne die täglich durchgeführen Bildvorstellungsübungen nicht eingetreten wäre.
In einer Anschluss-Studie unterwiesen Simonton und seine Kollegen 159 Krebspatienten, die als unheilbar galten, in diesen Vorstellungstechniken — mit einem durchaus beeindruckenden Resultat:
- 14 von ihnen zeigten keine Krankheitssymptome mehr,
- bei 12 war der Krebs
rückläufig
- und bei weiteren 17 hatte sich die Krankheit wenigstens nicht mehr verschlimmert.
Die zu erwartende Überlebensdauer liegt in solchen Fällen bei etwa 12 Monaten.
Nach 4 Jahren aber waren 63 dieser Patienten immer noch am Leben.
Die durchschnittliche Überlebenszeit der gesamten Gruppe war 24.4 Jahre — doppelt so lang wie der US-amerikanische Normwert.
Quelle: Stephanie Matthews-Simonton, Carl Simonton und James L. Creighton: Getting well again (New York: Bantam Books, 1980), S. 6-12.
Simonton hat noch eine Reihe ähnlicher Studien durchgeführt, stets mit positiven Resultaten.
Obgleich sein Verfahren umstritten blieb, fanden einige Forscher seine Versuchsergebnisse so überzeugend, dass er das Simonton Cancer Center aufbauen konnte, ein erfolgreiches Forschungs- und Behandlungszentrum in Pacific Palisades, Kalifornien, in dem Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen seine Bildvorstellungstechnik erlernen. Wie eine Bestandsaufnahme 1988 gezeigt hat, galt sie damals als die vierthäufigste a l t e r n a t i v e Krebsbehandlungsmethode.
Quelle: Jeanne Achterberg: Mind and Medicine: The Role of Imaginary in Healing, ASPR Newsletter 14, Juni 1988, Seite 20.
Heute wird seine Methode der Bildvorstellungstechniken nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Japan von aufgeschlossenen Ärzten angewandt, um die mit etablierten Therapien angestrebten Heilerfolge zu beschleunigen und nachhaltiger zu machen.
Wer Übungsanleitungen dazu sucht, findet sie z.B. in Jeanne Achterberg: Die heilende Kraft der Imagination, 1990.
In Deutschland werden auch Seminare dazu angeboten.
Beitrag 0-24
Der Placebo-Effekt belegt: Was uns steuert — auch als Materie — sind Überzeugungen
Zum ganz erstaunlichen Stellenwert des Placebo-Effekts
Bruce Lipton, ein Zellbiologe, versucht schon seit etwa 1970 seinen Fachkollegen klar zu machen, wie wichtig es ist, dass die Biologie aufhört, jedes Lebewesen nur reduziert auf seinen rein materiell existierenden Teil zu betrachten. Er hat dafür sehr gute Argumente (wie mir die Lektüre seines Buches » Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern « klar gemacht hat). Vieles ist allein schon seiner zusammenfassenden Erklärung des Entstehens von Leben, Bewusstsein und Gehirn zu entnehmen.
Wer sich nicht die Mühe machen möchte, sein Buch zu lesen, um mehr darüber zu lernen, wie der Geist den Körper steuert und beinflusst, könnte dennoch daran interessiert sein, wenigstens über den allseits bekannten — auch von der Schulmedizin anerkannten — Placebo-Effekt etwas dazuzulernen:
Besonders klar — und durch Messungen der Gehirnströme über jeden Zweifel erhaben — wurde der Placebo-Effekt und die Macht der Überzeugungen nachgewiesen durch ein im Jahr 2014 an der TU München durchgeführtes Expirement:
Nocebos: Die Macht n e g a t i v e r Überzeugung
Wenn der Geist durch p o s i t i v e Suggestion zur Heilung beiträgt, nennt man das den Placebo-Effekt.
Wenn nun aber umgekehrt der Geist durch n e g a t i v e Suggestion die Gesundheit schädigt, spricht man vom Nocebo-Effekt.
Natürlich beruhen beide auf ein und demselben Mechanismus:
Und hier das allgemeine Prinzip:
Östliche Philosophie sprach es so aus (war sich aber wohl nicht bewusst, dass man unter den » Gewohnheiten « hier a u c h das zu verstehen hat, was jede einzelne Zelle unseres Körpers sich angewöhnt hat):
Deine Überzeugungen werden deine Gedanken
Deine Gedanken werden deine Worte
Deine Worte werden dein Handeln
Dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten
Deine Gewohnheiten formen deine Werte
Deine Werte werden zu deiner Bestimmung
Bruce Lipton, ein Zellbiologe, versucht schon seit etwa 1970 seinen Fachkollegen klar zu machen, wie wichtig es ist, dass die Biologie aufhört, jedes Lebewesen nur reduziert auf seinen rein materiell existierenden Teil zu betrachten. Er hat dafür sehr gute Argumente (wie mir die Lektüre seines Buches » Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern « klar gemacht hat). Vieles ist allein schon seiner zusammenfassenden Erklärung des Entstehens von Leben, Bewusstsein und Gehirn zu entnehmen.
Wer sich nicht die Mühe machen möchte, sein Buch zu lesen, um mehr darüber zu lernen, wie der Geist den Körper steuert und beinflusst, könnte dennoch daran interessiert sein, wenigstens über den allseits bekannten — auch von der Schulmedizin anerkannten — Placebo-Effekt etwas dazuzulernen:
Bruce Lipton (S. 135-140, etwas gekürzt)
Jeder Medizinstudent lernt, dass Patienten sich oft schon dann besser fühlen, wenn sie nur annehmen, dass man sie behandelt hat. Dieser Effekt ist erstaunlicher Beweis für die Heilkraft des Körper-Geist-Systems. Für den typischen Schulmediziner grenzt der » doch nur eingebildete « Placebo-Effekt an Quacksalberei oder wird von ihm darauf zurückgeführt, dass der Patient schwach und leicht beinflussbar sei. Medizinische Fakultäten erwähnen den Placebo-Effekt deswegen nur am Rande, um sich so möglichst schnell ihren » wirksameren « Heilmethoden zuwenden zu können.
Ich [ Bruce Lipton ] halte das für einen kapitalen Fehler. Der Placebo-Effekt sollte in der medizinischen Ausbildung eine ganz wichtige Rolle spielen. Man darf die Kraft des Geistes nicht unterschätzen: Sie ist nicht weniger wirksam als Chemikalien und Skalpelle. Die Schulmedizin sollte nicht mehr länger glauben, dass unser Körper dumm und unsere Gesundheit nur mit äußerer Hilfe aufrecht zu erhalten sei.
Der Placebo-Effekt bedarf gründlicher wissenschaftlicher Untersuchung, denn könnte man herausfinden, wie man ihn steuert, wäre er ein höchst effizientes, nebenwirkungsfreies Intrument zur Krankheitsbekämpfung.
Manche Historiker weisen darauf hin, dass der Placebo-Effekt in der Medizin seit jeher eine große Rolle gespielt hat. Das muss schon deswegen so gewesen sein, da die Mediziner ja noch bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts über gar keine wirksamen Methoden verfügten (Krankheiten wurden mit Aderlass behandelt, Wunden mit Arsen, und wenn gar nicht mehr half, kam als "Allheilmittel" Klapperschlangenöl zum Einsatz). Und doch ging es so manchem Patienten selbst nach solcher Behandlung besser — ganz so wie heute, wenn ein Arzt im weißen Kittel seinem Patienten im Brustton der Überzeugung die hohe Wirksamkeit der Pille erklärt, die er verschreibt und die doch nur ein Placebo ist.
Was uns heilt muss also doch in erster Linie unsere Überzeugung sein!
Obgleich die Frage danach, wie Placebos wirken, im Großen und Ganzen von der Schulmedizin ignoriert wird, haben sich in letzter Zeit doch auch ein paar angesehne Wissenschaftler damit beschäftigt. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass selbst Scheinoperationen Wirkung zeitigen können:Eine 2002 im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie der Baylor School of Medicine überwachte Patienten, die sich wegen schwerer Knieschmerzen operieren lassen wollten. Der Leiter der Untersuchung, Dr. Bruce Moseley, wollte herausfinden, welche Art von Operation seinen Patienten am besten half. Er ordnete seine Patienten jeweils einer von 3 Gruppen zu:
- Denen aus Gruppe 1 wurde der geschädigte Knorpel abgeschliffen.
- Denen aus Gruppe 2 wurde das Gelenk gespült und so alles Material entfernt, das eine Entzündung verursachen konnte.
- Gruppe 3 aber wurde nur zum Schein operiert: Der Patient wurde betäubt, Moseley machte die 3 Standardeinschnitte und redete und bewegte sich so, als führe er eine Operation durch — er planschte sogar mit etwas Salzwasser, um die Geräusche der Kniewaschung nachzuahmen. Nach 40 Minunten nähte er die Schnitte wieder zu, ganz so, wie er es bei einer gewöhnlichen Operation auch getan hätte.
Alle 3 Gruppen erhielten gleiche postoperative Behandlung, zu der auch ein Gymnastikprogramm gehörte.
Die Ergebnisse waren schockierend:
- Ja, die wirklich operierten Patienten aus Gruppe 1 und 2 erfuhren die erwartete Besserung.
- Der Placebo-Gruppe aber ging es ebenso gut!
Dr. Moseley » wusste «, dass die Knieoperationen helfen würden, und er » wusste «, dass es im Bereich von Operationen kein Placebo-Effekt zu erwarten war — und dennoch war genau der eingetreten!
Im Fernsehen ausgestrahlte Reportagen stellten die erstaunlichen Ergebnisse ausführlich dar. Sie zeigten Mitglieder der Placebo-Gruppe, die nun wandern gingen bzw. Basketball spielten — alles Dinge, die ihnen vor ihrer Scheinoperation unmöglich waren.
Man hat diesen Patienten erst 2 Jahre später mitgeteilt, dass man sie gar nicht operiert hatte. Ein Mitglied dieser Gruppe, Tim Perez, konnte vor der Operation nur mit einem Stock gehen — jetzt aber spielte er mit seinen Enkeln Fußball. Im Interview sagte er: In dieser Welt ist alles möglich, wenn man es sich in den Kopf setzt: Ich weiß jetzt, dass unser Geist Wunder vollbringen kann.
Auch bei der Behandlung anderer Krankheiten, darunter Astma und Parkinson, haben Placebo-Effekte schon starke Wirkung gezeigt. Und bei der Behandlung von Depressionen waren sie gar so effektiv, dass der Psychiater, Walter Brown, Placebo-Pillen als Erstbehandlung für leichte und mittlere Depressionen vorschlug [Brown 1998]. Browns Untersuchungen haben gezeigt, dass die Placebo-Pillen sogar dann funktionierten, wenn die Patienten wussten, dass sie kein wirkstoffhaltiges Medikament erhielten.
Ein weiter Hinweis auf die Macht der Placebos (d.h. die Macht positiven Denkens) findet sich in einem Bericht des amerikanischen Gesundheitsministeriums:Darin steht [ Horgan, 1999 ], dass sich in einer Studie die Hälfte der betrachteten depressiven Patienten nach der Einnahme eines Medikaments besser fühlten, während es bei der Placebo-Kontrillgruppe immerhin noch 32 Prozent waren.
Angesichts solcher Effektivität des Placebo-Effekts ist es nicht erstaunlich, dass die 8.2 Mrd Dollar schwere Antidepressiva-Industrie sich der Kritik stellen muss, dass die Pharmakonzerne die Wirksamkeit ihrer Mittel recht schamlos übertreibt.
Irving Kirsch, ein klinischer Psychologe, hat 2002 festgestellt, dass gemäß klinischer Studien etwa 80 Prozent der Wirkung von Antidepressiva auf den Placebo-Effekt zurückzuführen seien.
Um Zugriff auf die Daten der Untersuchungen zu den meist verkauften Antidepressiva zu bekommen, musste er sich auf die verfassungsrechtlich garabtierte Informationsfreiheit berufen, denn die Gesundheitsbehörden wollten sie herausgeben.
In einem Interview mit dem Discovery Channel sagte Kirsch: Der Unterschied zwischen der Reaktion auf das Medikament und der Reaktion auf das Placebo betrug im Durchschnitt weniger als 2 Punkte auf einer klinischen Skala, die 50 bis 60 Punkte erreicht. Kirsch sah diesen Unterschied als, wie er wörtlich sagte, » klinisch bedeutungslos «.
Eine interessante Tatsache zur Wirksamkeit von Antidepressiva ist auch, dass sie in den klinischen Versuchen im Laufe der Jahre immer besser abschnitten. Diese lässt darauf schließen, dass ihre Wirkung zum Teil auf geschickter Vermarktung beruht (allein auf dem Glauben also, dass sie wirken).
Dass oft nur der Glaube an ihre Wirkung die Wirkung zeitigt, beweist der Fall Janis Schonfeld aus 1997:
Sie nahm an einem Test der Wirksamkeit des Mittels Effexor teil und war absolut verblüfft, als man sie später darüber informierte, dass sie nur ein Placebo bekommen hatte:
Diese Pillen nämlich hatten sie nicht nur von ihrer jahrelangen Depression befreit, die EEGs zeigten auch, dass ihre Großhirnrinde nun viel aktiver war als zuvor [ Leuchter et al., 2002 ]. Zudem hatte Schonfeld während der Behandlung an Übelkeit gelitten, einer bekannten Nebenwirkung von Effexor, über die man sie informiert hatte.
Schonfeld war, nachdem die Ärzte ihr eröffnet hatten, sie habe nur ein Placebo genommen, fest davon überzeugt, dass man sich geirrt haben müsse. Die Wissenschaftler mussten ihren Bericht zweimal überprüfen, bis sie ihnen glaubte.
Zitierte Quellen:
- Kirsch I. et al (2002): The Emperor's New Drugs: An Analysis of Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug Association. Prevention & Treatment, American Phsychological Association 5: Article 23
- Leuchter A.F. et al (2002): Changes in Brain Function of Depressed Subjects During Treatment with Placebo. American Journal of Psychiatry 159(1): 122-129
- Moseley J.B. (2002): A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee. New England Journal of Medicine 347(2): 81-88
- Horgan J. (1999): Prozac and Other Placebos. The Undiscovered Mind: How the human Brain defies Replication, Medication, and Explanation. New York, The Free Press, pp 102-136
Besonders klar — und durch Messungen der Gehirnströme über jeden Zweifel erhaben — wurde der Placebo-Effekt und die Macht der Überzeugungen nachgewiesen durch ein im Jahr 2014 an der TU München durchgeführtes Expirement:
Prof. Markus Ploner, TU München (2015):
Zwanzig Probanden erhielten zuerst unterschiedlich starke schmerzhafte Laserpulse abwechselnd auf zwei Bereiche auf ihrem Handrücken. Die Wahrnehmung eines jeden Schmerzreizes wurde anschließend mündlich bewertet.
Im weiteren Verlauf des Experiments erhielten sie die gleichen Reize noch einmal mit dem Unterschied, dass vorher beide Bereiche eingecremt wurden. Obwohl beide Cremes ohne Wirkstoff waren, bekamen die Probanden gesagt, dass eine der Cremes eine schmerzlindernde Wirkung habe.
Das Ergebnis: Die Probanden bewerteten die Schmerzen auf dem Hautbereich mit der angeblich schmerzlindernden Creme signifikant schwächer als auf der anderen Hautstelle.
Die Wissenschaftler konnten das auch im Gehirn sichtbar machen: Trotzdem die Probanden die gleichen Schmerzreize erhielten, feuerten die Nervenzellen beim zweiten Durchlauf ein anderes Muster von Signalen.
Wenn der Geist durch p o s i t i v e Suggestion zur Heilung beiträgt, nennt man das den Placebo-Effekt.
Wenn nun aber umgekehrt der Geist durch n e g a t i v e Suggestion die Gesundheit schädigt, spricht man vom Nocebo-Effekt.
Natürlich beruhen beide auf ein und demselben Mechanismus:
Bruce Lipton (S. 140-141, etwas gekürzt)
In der Medizin kann der Nocebo-Effekt ebenso mächtig sein wie der Placebo-Effekt. Wer ins Sprechzimmer eines Arztes spricht, sollte das wissen — und vor allem sollte der Arzt sich dieses Zusammenhangs stets bewusst sein. Wenn er einem Patienten sagt » Sie haben höchstens noch 6 Monate zu leben « (und wenn der ihm glaubt), wird das die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so kommt, deutlich erhöhen. In der Sendereihe Placebo: Mind over Matter des Discovery Channel von 2003 wird über einige höchst interessante medizinische Fälle berichtet.
Einer dieser Berichte handelte von einem Arzt aus Nashville. Clifton Meador hatte gut 30 Jahre lang den Nocebo-Effekt erforscht und war dabei 1974 auf einen Schuverkäufer inm Ruhestand gestoßen, Sam Londe, bei dem man Speiseröhrenkrebs diagnostiziert hatte — eine Krankheit, die damals als mit Sicherheit tödlich galt. Londes Krebs wurde behandelt, aber unter Medizinern war klar, dass er wiederkehren würde. Daher war niemand überrascht, als Londe wenige Wochen nach der Diagnose starb.Die Autopsie des Toten aber brachte eine große Überraschung: Man fand nur sehr wenig Krebs in seinem Körper, auf keinen Fall genug, um daran zu sterben: In seiner Leber und seiner Lunge fanden sich ein paar Flecken, aber keine überhaupt keine Spur von Speiseröhrenkrebs, der doch für seinen Tod verantwortlich sein sollte. Woran also war Londe gestorben, wenn nicht an Krebs? Starb er, weil er glaubte, dass er sterben würde?
Dieser Fall verfolgte Meador noch drei Jahrzehnte nach Londes Tod. Ich dachte, er hätte Krebs. Er dachte, er hätte Krebs. Jeder um ihn herum dachte das. Haben wir ihm die Hoffnung genommen [und so seinen Tod verursacht]?
Bruce Lipton, (S. 142-143, etwas gekürzt)
Unsere Überzeugungen — seien sie positiv oder negativ — beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit, sondern jeden Aspekt unseres Lebens. Henry Ford hatte recht, als er sagte:
Ob du glaubst, du kannst es,
oder ob du denkst, du kannst es nicht
du wirst stets recht behalten.
Unsere Überzeugungen sind wie die Filter vor dem Objektiv einer Kamera — sie verändern unseren Blick auf die Welt, und unsere Biologie passt sich dem an, was wir sehen bzw. zu sehen glauben. Wenn wir anerkennen, dass unsere Überzeugungen solche Anpassung hervorrufen, dass sie also derart mächtig sind, haben wir den Schlüssel gefunden, unser Wohlbefinden in durchaus nennenswertem Umfang zu steuern.
Mit unserer genetischen Veranlagung müssen wir leben — unsere Meinung und Überzeugung aber k ö n n e n wir ändern.
In meinen Vorträgen verteile ich an dieser Stelle rote und grüne Plastikfilter an die Zuhörer. Jeder ist frei, den einen oder anderen zu wählen. Dann bitte ich sie, laut in den Raum zu rufen, ob sie die Bilder, die ich nun an die Wand projeziere, als friedlich oder angsterregend wahrnehmen.
- Wer den roten » Überzeugungsfilter « gewählt hat, wird auf dem Dia das einladende Bild eines Häuschens, Blumen, und einen sonnigen Himmel sehen sowie die Botschaft » Ich lebe in Liebe und Frieden «.
- Wer nun aber durch einen der grünen Filter sieht, wird eine bedrohlichen Himmel, Fledermäuse und Schlangen sowie ein dunkles Haus sehen mit der Aussage » Ich lebe in Angst «.
Es begeistert mich immer wieder, wie aus demselbem in roten und grünen Farben gehaltenen Bild die einen herauslesen » Ich lebe in Liebe und Frieden « während die anderen herauslesen » Ich lebe in Angst «.
Dann bitte ich die Teilnehmer. durch den jeweils anderen Filter zu schauen. Es geht mir darum, zu zeigen, dass wir w ä h l e n können, was wir sehen.
Sie, lieber Zuhörer, können in Frieden oder in Angst leben. Sie h a b e n die Wahl, zu was es kommt.
Wenn Sie sich für ein Leben voller Angst entscheiden, wird Ihre Gesundheit in dem Maße nachlassen, in dem Sie sich als Reaktion darauf hinter einen Schutzpanzer zurückziehen.
Lehrer wie Buddha und Jesus haben uns das schon seit Jahrtausenden erzählt. Jetzt ist es auch für die Wissenschaft nachvollziehbar:
Nicht unsere Gene,
sondern unsere Überzeugung — subjektive Wahrnehmungen — steuern unser Leben.
Leben in diesem Sinne umfasst unsere u n b e w u s s t e n , aber auch all unsere b e w u s s t e n Reaktionen auf unsere Umwelt.
Östliche Philosophie sprach es so aus (war sich aber wohl nicht bewusst, dass man unter den » Gewohnheiten « hier a u c h das zu verstehen hat, was jede einzelne Zelle unseres Körpers sich angewöhnt hat):
Deine Überzeugungen werden deine Gedanken
Deine Gedanken werden deine Worte
Deine Worte werden dein Handeln
Dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten
Deine Gewohnheiten formen deine Werte
Deine Werte werden zu deiner Bestimmung
Beitrag 0-30
Wie Zellen aus quantenchemischer Sicht funktionieren
Aufbau und Funktion biologischer Zellen
Jede Zelle besteht aus zwei wichtigen Teilen:
Die Umweltsignale treffen auf Proteine (sog. Regulationsproteine), die bewirken, dass ein und dasselbe Gen gut 2000 verschiedene Varianten eines Proteins erzeugen kann.
Warum aber will die Zelle denn überhaupt Proteine erzeugen?
Jede Zelle besteht aus 4 Typen großer Moleküle: Polysacchariden (Zucker), Lipiden (Fett), Nukleinsäuren (DNS/RNS) und Proteinen.
Die Zellen brauchen alle, aber am wichtigsten und weit zahlreicher als alle anderen sind die Proteine: Unser Körper braucht etwa 100.000 verschiedene Proteine, um zu funktionieren (kann aber, potentiell, bis zu 25.000 • 2.000 = 50.000.000 verschiedener Varianten davon erzeugen. Wir werden noch sehen, warum.
Jedes Protein ist eine lange Kette wie über Kugelgelenke miteinander verbundener Moleküle, die Aminosäuren sind. Die meisten tragen positive oder negative Ladung, und so bewirken elektromagenische Kräfte, dass sie einander abstoßen oder anziehen, wodurch es dann dazu kommt, dass die gesamte Kette sich biegt und letztlich die Form eines Fadens hat, den man zusammengeknüllt hat. Da die beiden End-Aminosäuren des Fadens negative Ladung haben, sich also abstoßen, haben sie die Tendenz, sich möglichst weit voneinander zu entfernen, so dass die Kette keinen beliebig kompakten zusammengeknüllten Zustand annehmen kann.
Die genaue räumliche Verteilung der Anordnung der Aminosären in der Kette spiegelt einen ausgeglichenen Zustand seiner elekromagnetischen Ladungen wider (eine Art Gleichgewichtszustand des Protein-Moleküls, den die Biologen seine Konformation nennen.
Diese sehr gelenkigen, beweglichen Proteine stellen aufgrund ihrer Bauweise ein noch eindrucksvolleres Wunder dar, die ihre präzisen 3-dimensionalen Formen erlauben jedem Protein, sich mit anderen zu verbinden: Wenn sich Proteine begegnen, sie physisch und energetisch zu einander passen, verbinden sie sich bis schließlich etwas entsteht, das an das Getriebe oder Räderwerk einer alten Taschenuhr erinnert.
Doch zurück zu Zelle, Zellkern und Zellmembran:
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es U m w e l t s i g n a l e sind, die Protein-Erzeugung anstoßen (indem sie die Regulationsproteine in der Schutzhülle um die DNS beeinflussen, die DNA dann Information an die RNA weiterleitet und deren Gene dann neue Protein-Moleküle erzeugen).
Inzwischen gilt als gesichert, dass ein sehr viel dünnerer Fluss von Information auch in umgekehrter Richtung stattfindet, so dass die RNS gelegentlich auch den genetischen Code, die DNA, umschreiben wird. Howard Temin, der das in den 60-er Jahren entdeckte, wurde zunächst verlacht, bekam aber später den Nobelpreis für eben diese Entdeckung ( der reversiven Transkriptase, wie man das heute nennt ).
Reversive Transkriptase erlangte traurige Berühmtheit, als klar wurde, dass die RNS des AIDS-Virus über diesen Weg die DNS der infizierten Zelle manipuliert.
Genetik beschreibt den Einfluss der DNS, Epigenetik den Einfluss der Umweltsignale auf die Produktion der Proteine.
Da ankommende Umweltsignale durch die Regulationsproteine modifiziert werden, ist jedes neu produzierte Protein-Molekül in der nun konkret entstehenden Variante Funktion aller drei an seiner Produktion beteiligten Instanzen:
Damit wird klar:
Wie ein Körper sich fortentwickelt
bestimmt neben seinen Genen ganz wesentlich auch die U m w e l t , in der er lebt
( d.h. nahezu alles, was daraus mit seinen Zellen in Berührung kommt )
Quelle: Lipton, B. (2006): Intelligente Zellen, Kap. 2 (S. 49-74)
DNS-Moleküle sind fadenförmig und bestehen aus vier stickstoff-haltigen Basen: A, T, C, G = Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Die Sequenz, in der diese Basen auftreten, bestimmt die Sequenz der Aminosäuren in jedem einzelnen Protein. Zudem sind die DNS-Fäden in Segmente unterteilt, die man Gene nennt: Kopiervorlage für je ein bestimmtes Protein.
Nebenbei: Selbst die erst nach der Jahrtausendwende entstande Literatur zum Umfang des meschlichen Genoms, ist sich keineswegs darüber einig, um wie viele Gene genau es sich denn hierbei eigentlich handelt. Sicher scheint jetzt nur zu sein, dass kaum 25.000 sind (also viel weniger als die rund 150.000, die man noch Mitte der 90-er Jahre erwartet hatte).
Der Nobelpreisträger David Baltimore, einer der weltweit angesehensten Gentechniker überhaupt, schrieb 2001: F a l l s im menschlichen Genom nicht noch viele Gene gibt, die unsere Computer bislang nicht erkennen konnten, müssen wir zugeben, dass wir unsere im Vergleich zu Würmern und Pflanzen zweifellos größere Komplexität nicht durch zusätzliche Gene gewonnen haben ...
Noch erstaunlicher [Bruce Lipton: Intelligente Zellen (2006) S. 64-65]:
Wir müssen daraus wohl schließen, dass die Komplexität und Entwicklungsstufe, die einem biologischen Wesen zugeordnet sind, kaum etwas mit der Zahl G seiner Gene zu tun hat. Allerdings korrespondiert die Zahl B der Basenpaare, die sich in einem Genom finden, auch nicht unbedingt mit der Zahl der Gene: Nach Wikipedia ist
Jede Zelle besteht aus zwei wichtigen Teilen:
- dem Zellkern: Er sicher das Überleben der Zelle.
- und einer Zellmembran, d.h. einer Hülle, die sozusagen das Gehirn der Zelle darstellt: Die Membran empfängt Umweltsignale, so dass jene — mehr oder weniger modifiziert — den Zellkern erreichen und dort zur Produktion von Produktion von Proteinen führen.
Die Umweltsignale treffen auf Proteine (sog. Regulationsproteine), die bewirken, dass ein und dasselbe Gen gut 2000 verschiedene Varianten eines Proteins erzeugen kann.
Warum aber will die Zelle denn überhaupt Proteine erzeugen?
Jede Zelle besteht aus 4 Typen großer Moleküle: Polysacchariden (Zucker), Lipiden (Fett), Nukleinsäuren (DNS/RNS) und Proteinen.
Die Zellen brauchen alle, aber am wichtigsten und weit zahlreicher als alle anderen sind die Proteine: Unser Körper braucht etwa 100.000 verschiedene Proteine, um zu funktionieren (kann aber, potentiell, bis zu 25.000 • 2.000 = 50.000.000 verschiedener Varianten davon erzeugen. Wir werden noch sehen, warum.
Jedes Protein ist eine lange Kette wie über Kugelgelenke miteinander verbundener Moleküle, die Aminosäuren sind. Die meisten tragen positive oder negative Ladung, und so bewirken elektromagenische Kräfte, dass sie einander abstoßen oder anziehen, wodurch es dann dazu kommt, dass die gesamte Kette sich biegt und letztlich die Form eines Fadens hat, den man zusammengeknüllt hat. Da die beiden End-Aminosäuren des Fadens negative Ladung haben, sich also abstoßen, haben sie die Tendenz, sich möglichst weit voneinander zu entfernen, so dass die Kette keinen beliebig kompakten zusammengeknüllten Zustand annehmen kann.
Die genaue räumliche Verteilung der Anordnung der Aminosären in der Kette spiegelt einen ausgeglichenen Zustand seiner elekromagnetischen Ladungen wider (eine Art Gleichgewichtszustand des Protein-Moleküls, den die Biologen seine Konformation nennen.
Diese sehr gelenkigen, beweglichen Proteine stellen aufgrund ihrer Bauweise ein noch eindrucksvolleres Wunder dar, die ihre präzisen 3-dimensionalen Formen erlauben jedem Protein, sich mit anderen zu verbinden: Wenn sich Proteine begegnen, sie physisch und energetisch zu einander passen, verbinden sie sich bis schließlich etwas entsteht, das an das Getriebe oder Räderwerk einer alten Taschenuhr erinnert.
Doch zurück zu Zelle, Zellkern und Zellmembran:
- Wird einer Zelle ihre Membran genommen, ist die Zelle sofort nur noch totes Material.
- Nimmt man ihr jedoch den Zellkern, so kann sie noch bis zu einem Monat weiter Umweltsignale aufnehmen und verarbeiten, stirbt danach aber dennoch, denn ohne Zellkern
- kann sie sich nicht teilen (also fortpflanzen)
- und kann defekt gewordene Proteine auch nicht mehr durch neue ersetzen (denn nur die Gene in der RNA können das, die RNA aber residiert im Zellkern als » Arbeitskopie « der DNA.
- Die DNA wiederum hat man als » Sicherungskopie der Erbinformation « zu sehen. Kopien in diesem Sinne sind logische Kopien, denn chemisch unterscheiden sich DNA und RNA sehr wohl.
- kann sie sich nicht teilen (also fortpflanzen)
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es U m w e l t s i g n a l e sind, die Protein-Erzeugung anstoßen (indem sie die Regulationsproteine in der Schutzhülle um die DNS beeinflussen, die DNA dann Information an die RNA weiterleitet und deren Gene dann neue Protein-Moleküle erzeugen).
Inzwischen gilt als gesichert, dass ein sehr viel dünnerer Fluss von Information auch in umgekehrter Richtung stattfindet, so dass die RNS gelegentlich auch den genetischen Code, die DNA, umschreiben wird. Howard Temin, der das in den 60-er Jahren entdeckte, wurde zunächst verlacht, bekam aber später den Nobelpreis für eben diese Entdeckung ( der reversiven Transkriptase, wie man das heute nennt ).
Reversive Transkriptase erlangte traurige Berühmtheit, als klar wurde, dass die RNS des AIDS-Virus über diesen Weg die DNS der infizierten Zelle manipuliert.
Genetik beschreibt den Einfluss der DNS, Epigenetik den Einfluss der Umweltsignale auf die Produktion der Proteine.
Da ankommende Umweltsignale durch die Regulationsproteine modifiziert werden, ist jedes neu produzierte Protein-Molekül in der nun konkret entstehenden Variante Funktion aller drei an seiner Produktion beteiligten Instanzen:
- dem ankommenden Signal (das ein Molekül oder ein Boson sein kann),
- dem Regulationsprotein (das mit dem Signal kollidiert) und
- dem Gen (das zusammen mit dem neuen Zustand des Regulationsproteins zur Bildung des Proteins führt, welches die Zelle weiter entwickelt).
Damit wird klar:
bestimmt neben seinen Genen ganz wesentlich auch die U m w e l t , in der er lebt
( d.h. nahezu alles, was daraus mit seinen Zellen in Berührung kommt )
Quelle: Lipton, B. (2006): Intelligente Zellen, Kap. 2 (S. 49-74)
DNS-Moleküle sind fadenförmig und bestehen aus vier stickstoff-haltigen Basen: A, T, C, G = Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Die Sequenz, in der diese Basen auftreten, bestimmt die Sequenz der Aminosäuren in jedem einzelnen Protein. Zudem sind die DNS-Fäden in Segmente unterteilt, die man Gene nennt: Kopiervorlage für je ein bestimmtes Protein.
Nebenbei: Selbst die erst nach der Jahrtausendwende entstande Literatur zum Umfang des meschlichen Genoms, ist sich keineswegs darüber einig, um wie viele Gene genau es sich denn hierbei eigentlich handelt. Sicher scheint jetzt nur zu sein, dass kaum 25.000 sind (also viel weniger als die rund 150.000, die man noch Mitte der 90-er Jahre erwartet hatte).
Der Nobelpreisträger David Baltimore, einer der weltweit angesehensten Gentechniker überhaupt, schrieb 2001: F a l l s im menschlichen Genom nicht noch viele Gene gibt, die unsere Computer bislang nicht erkennen konnten, müssen wir zugeben, dass wir unsere im Vergleich zu Würmern und Pflanzen zweifellos größere Komplexität nicht durch zusätzliche Gene gewonnen haben ...
Noch erstaunlicher [Bruce Lipton: Intelligente Zellen (2006) S. 64-65]:
- Der primitive Fadenwurm — der ein aus exakt 969 Zellen bestehender, schnell wachsender, sich rasch vermehrender Organismus mit einem Gehirn aus nur etwa 300 Zellen ist —
verfügt über ein Genom aus etwa 24.000 Genen.
- Die Fruchtfliege aber, die einen weit weniger primitiven Organismus darstellt, hat ein nur halb so umfangreiches Genom.
Wir müssen daraus wohl schließen, dass die Komplexität und Entwicklungsstufe, die einem biologischen Wesen zugeordnet sind, kaum etwas mit der Zahl G seiner Gene zu tun hat. Allerdings korrespondiert die Zahl B der Basenpaare, die sich in einem Genom finden, auch nicht unbedingt mit der Zahl der Gene: Nach Wikipedia ist
- ( G, B ) = ( 30.907, 200.000.000 ) beim gemeinen Wasserfloh, aber
- ( G, B ) = ( 22.500, 3.000.000.000 ) beim Menschen
Beitrag 0-25
Wie es zu biologischer Intelligenz, Leben und Bewusstsein kommt
Wie es zu biologischer Intelligenz, Leben und Bewusstsein kommt
In seinem Buch Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern beschreibt der Zellbiologe Bruce Lipton
Lipton skizziert dann auch, wie es zu Leben, Bewusstsein, Gehirn und zunehmend mehr Intelligenz kommt:
Wirklich ü b e r z e u g t zu sein ist wichtig,
denn nur rein formal positiv zu denken — darauf weist Lipton auch hin — reicht nicht:
In seinem Buch Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern beschreibt der Zellbiologe Bruce Lipton
- welche Art von Intelligenz allein schon jeder einzelnen Zelle biologischer Wesen innewohnt,
- nach welchem Prinzip sie funktioniert
- und auch, dass die Natur sie nicht im Zellkern, sondern in der Zellmembran implementiert:
Lipton skizziert dann auch, wie es zu Leben, Bewusstsein, Gehirn und zunehmend mehr Intelligenz kommt:
Bruce Lipton (S. 126-129, etwas gekürzt)
In den vorangehenden Kapiteln wurde gezeigt,
- dass schon die Membran jeder Zelle gewisse Intelligenz enthält,
- dass die Membran nach Struktur und Funktionsweise einem Computer-Chip vergleichbar ist
- und wie die Funktionen der Zellen infolge molekularer Bewegungen des "Protein-Gewebes" aufgerufen werden.
Die Bewegung der Protein-Bausteine wird durch Umweltsignale ausgelöst, wobei die Umweltsignal-Stoffe (aus der Umgebung der Zelle kommend) sich mit den in der Zelle existierenden verhaltenserzeugenden zytoplasmischen Proteinen an der Zellmembran treffen: Die Membran empfängt Reize und erzeugt in Reaktion auf jedes solche Signal eine angemessene lebenserhaltende zelluläre Reaktion. In diesem Sinne kann die Zellmembran als » Gehirn « der Zelle gesehen werden, dessen physikalische Untereinheiten die integralen Rezeptor- und Effektor-Proteine der Membran sind (IMPs).
Wo ein Rezeptor-Protein R einen Reiz an ein Effektor-Protein E weiterleitet, startet das einen reaktionserzeugenden Protein-Prozess.
Jede Zelle reagiert auf in dieser Weise auf eine Vielzahl grundlegender » Wahrnehmungen « in ihrer Welt. Sie bemerkt z.B. die Anwesenheit von Kalium, Calcium, Sauerstoff, Glukose, Histamin, Östrogen, Gift, Licht oder was auch immer für sie einen Reiz darstellen kann.
Die gleichzeitige Reaktion zehntausender solch reflexiver Wahrnehmungsschalter in der Membran, deren jeder einem bestimmten Umweltsignal zugeordnet ist, erzeugen gemeinsam das komplexe Verhalten einer lebenden Zelle.
Während der ersten 3 Milliarden Jahre des Lebens auf unserem Planeten bestand die Biospähre nur aus freilebenden Einzellern wie Bakterien, Algen und Protozäen. Traditionell betrachten wir diese Lebensformen als Einzelwesen, doch inzwischen weiß man, dass individuelle Zellen bestimmte Signalmoleküle freisetzen können, die das Verhalten anderer Organismen beeinflussen. Dies führt zu einem koordinierten Verhalten einer verstreuten Population einzelliger Organismen. Derartige Bildung primitiver Gemeinschaften verbesserte die Überlebenschancen der Einzeller.
Die einzelligen Schleimpilz-Amöben sind gutes Beispiel dafür, wie Signalmoleküle zur Bildung einer Gemeinschaft führen: Sie leben vereinzelt im Boden und suchen nach Nahrung. Wenn jene aufgebraucht ist, erzeugen diese Einzeller einen Überschuss eines Stoffwechselproduktes namens cAMP, das sie an ihre Umgebung abgeben. Wenn diese freigesestzen Moleküle sich mit cAMP-Rezeptoren anderer Schleimpilz-Amöben verbinden, erzeugt es in ihnen ein Aggregationsverhalten, so dass ein mehrzelliger Körper (Fruchtkörper genannt) entsteht. Er stellt das Reproduktionsstadium des Schleimpilzes dar.
Während der Hungerperiode teilen die alternden Zellen ihre DNS miteinander und erzeugen eine nächste Generation. Die jungen Amöben überdauern zunächst als inaltive Sporen. Sobald es aber wieder Nahrung gibt, bilden die Nahrungsmoleküle das Signal der Aktivierung und eine neue Population von Einzellern beginnt ihr Dasein.
Mir geht es hier vor allem darum, dass einzellige Organismen in einer Gemeinschaft leben, in der sie ihre » Wahrnehmung « einander mitteilen und ihr Verhalten koordinieren, indem sie Signalmoleküle freisetzen. Das cAMP war eine der evolutionär frühesten Formen eines regulativen, verhaltensgesteuerten Sekrets.
Lange Zeit nahm man an, die grundlegenden menschlichen Signalmoleküle (allen voran Hormone, Neuropeptide, Zytikine und Wachstumsfaktoren) seinen erst im Zuge der Bildung mehrzelliger Lebensformen entstanden. Die jüngste Forschung aber hat gezeigt, dass sich schon die Einzeller in den frühesten Stufen der Evolution solcher Botenstoffe bedienten.
Im Laufe der Evolution maximierten die Zellen die Zahl der Wahrnehmungsproteine (der IMPs) in der Membran: Um mehr wahrzunehmen und damit die Wahrscheinlichkeit ihres Überlebens zu erhöhen, sammelten sich die Zellen zunächst in Form von Kolonien und später in Form hochorganisierter Zellverbände (die dann Organe und Gewebe des Körpers bilden). In gemeinschaftlichen Organisationsformen kommt es zur Spezialisierung der Zellen: Die intelligente Informationsverarbeitung der Zellmembran wird von den spezialisierten Zellen des Nerven- und des Immunsystems übernommen.
Erst vor etwa 700 Millionen Jahren erkannten die Zellen einen Vorteil darin, sich zu eng geknüpften mehrzelligen Gemeinschaften zusammenzuschließen, die wir als Pflanzen und Tiere bezeichnen. Die koordinierenden Signalmoleküle der freilebenden Einzeller behielten auch in diesen Gemeinschaften ihre Funktion und Rolle. Die Zellgemeinschaften aber konnten — durch Regulierung des Freisetzens und der Verteilung dieser steuernden Signalmoleküle — ihre Funktionen koordinieren und so als e i n Wesen agieren.
In Mehrzellern, die noch kein Nervensystem ausgebildet haben, implementieren die Signalmoleküle eine Art elementares "Denken", indem sie Information zwischen den Zellen transportieren. Nur in solchen Organismen nimmt noch wirklich j e d e Zelle sämtliche Reize der Umgebung wahr und reagiert darauf zielgerichtet.
Als die Zellgemeinschaften aber größer und komplexer wurden, musste eine neue Lösung gefunden werden: In zunehmend komplexeren Zellverbänden kann nicht jede Zelle einfach tun und lassen, was sie will — wirklich funktionieren kann die Gemeinschaft nur, wenn sich alle Beteiligten auf einen gemeinsamen Plan einlassen. Ein Grund hierfür ist, dass jede Zelle nur wahrnehmen kann, was in ihrer unmittelbaren Umgebung an Reizen vorhanden ist, sie hat keine Wahrnehmung dessen, was weiter entfernt oder gar außerhalb des Organismus abspielt. Die komplexen Verhaltenkontrollen, die ein mehrzelliger Organismus braucht, mussten Aufgabe zentraler Informationsverarbeitung werden. Dies führte zu einer Spezialisierung, die schuf, was man heute Nervenzellen nennt.
Auch entstand eine zentrale Verarbeitungsstelle: das Gehirn. Es erhielt höchste Wahrnehmungsautorität: Jede Zelle muss sich ihr beugen.
Dieser wichtige Punkt sollte berücksichtigt werden, wenn wir die Zellen unserer Organe und Gewebe für unseren Gesundheitszustand verantwortlich machen. Er erklärt, warum positives oder negatives Denken unsere Gesundheit fördern oder zerstören kann ( Placebo- und Nocebo-Effekt ).
In höheren, bewussteren Lebensformen entwickelt das Gehirn eine Spezialisierung, die es dem Organismus ermöglicht, sich auf seine regulatorischen Signale einzuschwingen. Dieses sog. limbische System übersetzt die chemischen Kommunikationssignale in Empfindungen, die von wirklich allen Zellen der Gemeinschaft wahrgenommen werden.
Wegen seiner Fähigkeit, den Fluss aller verhaltensregulierenden Signale in der Zellgemeinschaft zu koordinieren, war das limbische System ein großer evolutionärer Fortschritt. Je effizienter sich das innere Signalsystem machte, desto größer konnte das Gehirn werden. Auch entwickelten die mehrzelligen Organismen immer mehr Zellen, die auf eine zunehmend größer werdende Zahl aus der Umwelt kommender Nachrichten reagieren konnten.
Eine einzelne Zelle kann nur auf einfache sensorische Nachrichten (wie etwa rot, rund, aromatisch, etc.) reagieren. Erst die zusätzliche Geisteskraft vielzelliger Lebewesen ist in der Lage, diese einfachen Empfindungen zu solchen höherer Komplexität zusammenzusetzen (um z.B. einen Apfel als solchen zu erkennen).
Evolutionär erlerntes, grundlegendes Reflexverhalten wird durch genetisch festgelegte Instinkte an die Nachkommen vererbt. Die Evolution des Gehirns mit seiner zunehmenden Anzahl von Neuralzellen bot dem Organismus die Chance, sich nicht nur auf instinktives Verhalten zu verlassen, sondern auch aus Lebenserfahrung zu lernen. Neues Reflexverhalten entsteht durch Konditionierung. Das klassische Beispiel dafür sind Hunde, denen Pawlow beibrachte, beim Klingeln einer Glocke zu geifern, da sie gelernt hatten, dass solches Klingeln die unmittelbar bevorstehende Ankunft von Futter bedeutete. Dies war ein eindeutig unbewusstes, erlerntes Reflexverhalten.Konditionierte Verhaltensweisen können so anspruchsvoll sein, wie sie wollen: Man braucht dabei dennoch n i c h t zu denken, denn die neuralen Verbindungen sind durch einen vorausgegangenen Lernprozess » fest verdrahtet «, so dass immer gleiche Reaktion sichergestellt ist.
- Es gibt sehr einfache Reflexverhalten (wie etwa das Ausschlagen des Beines, wenn das Reflexhämmerchen aufs Knie schlägt),
- aber auch außerst komplexes Reflexverhalten (dann etwa, wenn wir mit 100 km/h bei dichtem Verkehr über die Autobahn fahren und gleichzeitig tief in Gedanken oder tief in ein Gespräch verwickelt sind).
Man nennt solche Reaktionsmuster » Gewohnheiten «.
Bei niedrigen Tieren dient das gesamte Gehirn der rein gewohnheitsmäßigen Reaktion auf Reize. Pawlows Hunde sabbern reflexartig, nicht absichtlich.
Das Unterbewusstsein handelt i m m e r reflexartig: Es unterliegt nicht der Vernunft oder dem Denken.
Menschen und höher entwickelte Tiere haben einen besonderen Bereich des Gehirns entwickelt, mit dem sie denken, planen und b e w u s s t e Entscheidungen treffen können: die vordere Großhirnrinde. Sie ist offenbar auch der Sitz des selbst-bewussten Denkvermögens — eine Art Sinnesorgan, mit dem wir uns selbst beobachten, unsere Gefühle überwachen können und auf langfristige Erinnerungen zurückgreifen können.
Die Fähigkeit des Bewusstseins, die vorprogrammierte Verhaltensweisen des Unterbewusstseins zu überschreiben, ist Grundlage unseres freien Willens.
Wenigstens beim Menschen ist die Lernfähigkeit des Gehirns so weit entwickelt, dass wir Wahrnehmungen — statt sie selbst zu erkennen — auch von unseren Lehrern übernehmen können. Sie verankern sich in unserem Gehirn und werden zu unser eigenen » Wahrheit «. Doch was, wenn unser Lehrer im Irrtum war (wir also mit Fehlinformation gefüttert werden)? Nun: Das Unterbewusstsein reagiert auf Reize gemäß seiner Programmierung und ist nicht in der Lage, sich über langfristige Konsequenzen Gedanken zu machen. Es arbeitet, wie eine Maschine. Unsere von anderen übernommene Fehleinschätzung zu überprüfen sieht es nicht vor. Und so kommt es, dass wir uns in manchen Dingen immer wieder unangemessen verhalten.
Kurz: Unsere Reaktionen auf Umweltreize werden durch unsere Wahrnehmungen gesteuert, doch nicht alle unserer » Wahrnehmungen « sind zutreffend. Daher wäre es richtiger, die steuernde » Wahrnehmung « eine Überzeugung zu nennen:
Was uns steuert, sind demnach Ü b e r z e u g u n g e n .
denn nur rein formal positiv zu denken — darauf weist Lipton auch hin — reicht nicht:
Lipton (S. 166-171, etwas gestrafft)
Die Evolution der höheren Säugetiere hat eine Wahrnehmungsebene hervorgebracht, die wir Selbstbewusstsein nennen. Sie stellt einen wichtigen evolutionären Fortschritt dar, denn unterbewusstes Denken (sozusagen unser » Autopilot «) ist fest konfiguriert, wohingegen unser bewusstes Denken (vergleichbar mit maunueller Steuerung eines Autos) sich dynamisch, d.h. von Fall zu Fall neu, konfiguriert. Wichtige Folge hiervon ist, dass
- bewusstes Denken pro Sekunde nur etwa 40 von außen kommende Reize verarbeiten kann,
- wohingegen unser Unterbewusstsein bis zu 20 Millionen pro Sekunde verarbeitet (als etwa 500.000 mal schneller ist).
Die beiden Arten unseres Denkens arbeiten unabhängig voneinander, was zur Folge hat, dass sich bewusstes Denken auf etwas konzentrieren kann (wie etwa auf die Party, zu der Sie am Freitag gehen wollen), während gleichzeitig Ihr Unterbewusstsein dafür sorgt, dass Sie Ihr Auto auch in dichtem Verkehr sicher und unfallfrei steuern.
Nur das b e w u s s t e D e n k e n verfügt über die Möglichkeit, auf Umwelteinflüsse auch kreativ zu reagieren. Insbesondere kann es durch Selbstreflexion sein Verhalten beobachten, während es abläuft, und es kann vorprogrammiertes Verhalten unterbrechen und neue Reaktionen entwickeln. Dieser Fähigkeit wegen ist bewusstes Denken die Quelle unseres freien Willens.
Beide Denkarten zusammen sind ein wirklich phänomenales Gespann: Das bewusste Denken ist unser Selbst, die Quelle unserer Kreativität und unseres freien Willens. Doch wer kümmert sich in der Zwischenzeit um das Tagesgeschäft? Das Unterbewusstsein. Und wie geht es diesen Geschäften nach? Genau so, wie es programmiert wurde.
Das Verhalten, das unser Unterbewusstsein an den Tag legt, entspricht nicht immer unseren Zielen, denn die meisten unserer grundlegenden Verhaltensweisen wurden durch die Beobachtung, vor allem auch durch die u n b e w u s s t e (nicht willensgesteuerte) Beobachtung anderer Menschen programmiert. Dies ist der Grund, warum viele Menschen überrascht sind, wenn sie hören, dass sie » genau so, wie ihre Mutter oder ihr Vater « reagieren (wie die Menschen also, durch deren Vorbild sie programmiert wurden). Die Vergeblichkeit unseres Kampfes mit unserem Unterbewusstsein ist eine schwierige Botschaft, denn die meisten von uns haben schon früh gelernt, dass ein starker Wille etwas Bewunderswertes ist. Also versuchen wir immer wieder, unser unbewusstes Programm zu überrumpfen. Diese Bemühungen aber treffen auf Widerstand, da die Zellen verpflichtet sind, dem unterbewussten Programm zu gehorchen.
Der Kampf unseres bewussten Willens gegen die uns unbewusste Programmierung kann zu ernsten neurologischen Störungen führen.Im auf einer wahren Geschichte beruhenden Film Shine wird das thematisiert: Der australische Konzertpianist David Helfgott trotzt seinem Vater, indem er nach London geht, um Musik zu studieren. Sein Vater aber — ein Holocaust-Überlebender — hat das Unterbewusstsein seines Sohnes dahingehend programmiert, dass die Welt ein unsicherer Ort sei, der lebensgefährlich sein kann. Der Vater besteht deswegen darauf, dass es am sichersten sei, möglichst nahe bei der Familie zu bleiben. Helfgott aber, der wusste, dass er das Zeug zu einem großartigen Pianisten hatte, versuchte sich vom Vater zu lösen, um seinen Traum wahr zu machen.
Zu den konventionellen Methoden, mit destruktivem Verhalten umzugehen, gehören Medikamente und Gesprächstherapien. Neuere Ansätze legen uns nahe, unsere Programmierung zu ändern, weil man erkannt hat, dass dem unterbewussten Tonband mit Vernunft nicht beizukommen ist. Diese Methoden bauen auf Erkentnissen der Quantenphysik auf und lassen sich unter dem Begriff Energetische Psychiologie zusammenfassen, ein aufkeimendes neues Feld, das auf der Neuen Biologie beruht.
In London spielt Helfgott in einem öffentlichen Musikwettbewerb das besonders schwierige Dritte Klavierkonzert von Rachmaninow. Der Film zeigt den Konflikt zwischen seinem bewussten Denken (das erfolgreich sein will) und seinem Unterbewusstsein (das es für lebengefährlich hält, sichtbar und bekannt zu werden). Helfgotts Bewusstsein erzwingt sich die Kontrolle, bis er — nun schweißüberströmt — den letzten Ton gespielt hat. Dann wird er ohnmächtig, weil ihn der Kampf mit seiner unbewussten Programmierung zu viel Energie gekostet hat. Sein Sieg über sein Unterbewusstsein kostet ihn einen hohen Preis: Als er wieder zu sich kommt, ist er geistesgestört.
Lipton (S. 126-126, nur der Hauptgedanke)
Bevor ich mich weiter über die unglaubliche Kraft unserer Gedanken und meine Studien über die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist auslasse, möchte ich noch eines klarstellen:
Ich bin keineswegs der Meinung, dass positives Denken immer körperliche Heilung bringt. Um Kontrolle über seinen Körper und sein Leben zu haben, bedarf es positiver Ü b e r z e u g u n g . Wenn Menschen bewusst nur so tun, als dächten sie positiv, schwächen sie sich dadurch eher, da ihnen dann ja bewusst ist, dass sie alle Möglichkeiten, Verbesserung ihres Lebens zu erreichen, erschöpft haben.
Da das Unterbewusstsein nun aber etwa 500.000 mal mehr neurologische Verarbeitungskapazität hat als das Bewusstsein, muss uns klar sein, welches der beiden Programme gewinnen wird: auf jeden Fall unser Unterbewusstsein (bei nur scheinbar positivem Denken also der Nocebo-Effekt ).
Beitrag 0-27
Wie auch Geist den Körper steuert — und sich dabei durchsetzen kann
Wie das zentrale Nervensystem die Reaktion der Körperzellen auf Umweltreize korrigieren kann
kurz:
Wie der Geist den Körper steuert
BruceLipton erklärt es so:
Referenzierter Forschungsbericht:
kurz:
Wie der Geist den Körper steuert
Bruce
Lipton (S. 134-135, gekürzt)
Die Erkenntnis, dass tiefe Überzeugungen Einfluss auf die Steuerung biologischer Prozesse nehmen, gewann ich aufgrund meiner Studien mit geklonten Endothelialzellen (Zellen aus der Innenwand der Blutgefäße): Die Zellen meiner Kulturen veränderten ihr Verhalten in Abhängigkeit der aus ihrer Umwelt kommenden Reize:
- Wenn ich den Zellen Nährstoffe gab, bewegten sie sich darauf zu.
- Wenn ich aber ihre Umgebung vergiftete, zogen die Zellen sich von diesem Reiz zurück, so als ob sie diese Moleküle fürchteten.
Meine Forschung konzentrierte sich auf die » Wahrnehmungsschalter « in der Membran der Zellen, die den Übergang vom einen zum anderen Verhalten steuern. Der wichtigste Schalter, mit dem ich mich befasste, hat einen Protein-Rezeptor, der auf Histamin reagiert (das der Körper als eine Art Alarmsystem einsetzt). Ich fand zwei Arten von Schaltern, H1 und H2, die auf das gleiche Histaminsignal reagieren:
- Wenn aktiviert, rufen die H1-Schalter eine Schutzreaktion hervor ähnlich der der Zellen in den Kulturschalen mit vergifteter Umgebung.
- Die H2-Histamin-Rezeptoren aber rufen einen Wachstumsimpuls hervor.
Nun ist es aber so, dass das Signal Adrenalin, mit dem der Körper auf allgemeine Notsituationen reagiert, ebenfalls zwei verschiedene, dieses Signal erkennende Rezeptoren hat: Alpha und Beta genannt. Die Andrealin-Rezeptoren führten zum gleichen Zellverhalten wie es bei den Histamin-Rezeptoren zustande kam:
- Wenn in einem IMP-Schalter ein Alpha-Adrenalin-Rezeptor sitzt, löst die Anwesenheit von Adrenalin eine Schutzreaktion aus.
- Wenn dort aber eine Beta-Andrealin-Rezeptor sitzt, aktiviert das gleiche Signal eine Wachstumsreaktion [ Lipton, Bensch, et al, 1992 ].
Wirklich aufregend aber wurde es, als ich meinen Zellkulturen gleichzeitig Histamin u n d Adrenalin zufügte: Ich konnte feststellen, dass die Adrenalinsignale (die im Körper vom Zentralnervensystem freigesetzt werden) stärker sind als die lokal freigesetzten Histaminsignale. Mit anderen Worten: Die Zellen in unserem Körper sind unterschiedlich einflussreich, wenn es darum geht, auf Signale zu reagieren.
Ich fand diese Beobachtung äußerst aufregend, da ich sie so interpretiere, dass der Geist — über das Adrenalin des zentralen Nervensystems — stärkerer Wirkung fähig ist als der Körper, dem das lokale Histaminsignal entspricht.
Ich wollte die Konsequenzen dieser Entdeckung in meinem Forschungsbericht erläutern, doch meine Kollegen traf fast der Schlag angesichts der Vorstellung, dass in einem zellbiologischen Bericht etwas über die Beziehung zwischen Geist und Körper stehen sollte. Sie wollten es nicht, da der Geist kein anerkanntes biologisches Modell abgibt. Biologen sind Newtonianer: Für sie zählt nur, was aus Materie besteht. Also fügte ich nur einen kryptischen Kommentar über die Bedeutung dieser Studie hinzu, ohne zu erklären, worin die Bedeutung zu sehen ist.
Mein Standpunkt: Die herkömmliche Überzeugung der Biologen, dass Geist — als örtlich scheinbar nicht lokalisierbare Energie — keine Wirkung auf Materie haben könne, ist eine erlernte Überzeugung, die nicht mehr haltbar erscheint für jeden, der die Erkenntnisse der Quantenphysik ernst nimmt. Biologen und Schulmediziner weigern sich noch, das zur Kenntnis zu nehmen.
Referenzierter Forschungsbericht:
- Lipton, Bensch, et al. (1992): Histamine-modulated Transdifferentiation of Dermal Microvascular Endothelial Cells, Experimental Cell Research 199: 279-291
Beitrag 0-29
Über die — derzeit wahrscheinlichste — wahre Natur aller biologischen Organismen
Zur wahren Natur aller biologischen Wesen
Wie sich aus durch
Hieraus folgt, dass dieses Wesen
Warum man von der Gültigkeit der ersten beiden dieser Aussagen ausgehen sollte sollte, wird gut erklärt auf Seite » Bruce Liptons Erkenntnisse und seine Schlussfolgerung daraus «.
Die dritte Eigenschaft aber wäre dann einfach nur triviale Folgerung gut gesicherter quantenphysikalischer Erkenntnisse nämlich:
Wichtige Folgerung aus all dem wäre dann auch, dass biologische Organismen, wirklich g e n a u betrachtet, kaum zueinander disjunkt sein können (aber auch das wissen wir ja schon: Wir brauchen da ja nur an uns selbst und an alle in unserem Körper lebenden Bakterien und/oder Viren zu denken, von einzelnen körpereigenen Zellen mal ganz abgesehen).
Wer Bruce Liptons Buch Intelligente Zellen gelesen hat, wird dann auch nicht mehr erstaunt darüber sein, dass jede Gemeinschaft biologischer Organismen — etwa die Gemeinschaft sämtlicher auf dieser Erde lebenden Menschen — ebenfalls biologischer Organismus im angenommenen Sinne ist. Kein Wunder also, dass die Evolution dieser speziellen Gemeinschaft durch die gleichen Naturgesetze getrieben wird, wie schon lange vor ihr (und natürlich auch jetzt noch) die Evolution großer biologischer Zellverbände ganz allgemein.
Wie sich aus durch
- Hans-Peter Dürr (dem Quantenphysiker)
- Rupert Sheldrake (dem Biologen und Verhaltensforscher) sowie
- Bruce Lipton (dem Zellbiologen)
Hieraus folgt, dass dieses Wesen
- wenigstens in seinen nicht-materiellen Teilen weit länger existieren kann als sein Körper,
- es in ganz extremen Ausnahmefällen sogar mehrfach mit gleicher biologischer Identität in körperliche Existenz hineingeboren werden kann
- vor allem aber, dass es — wie schwach auch immer — über das gesamte Universum hinweg verteilt existieren kann.
Warum man von der Gültigkeit der ersten beiden dieser Aussagen ausgehen sollte sollte, wird gut erklärt auf Seite » Bruce Liptons Erkenntnisse und seine Schlussfolgerung daraus «.
Die dritte Eigenschaft aber wäre dann einfach nur triviale Folgerung gut gesicherter quantenphysikalischer Erkenntnisse nämlich:
- Jede Welle breitet sich um die Stelle herum, an der sie erzeugt wurde, mit Lichtgeschwindigkeit kugelförmig ins gesamte Universum aus.
- Wellenpakete, unter denen man ja die Summe sehr vieler Wellen versteht,
haben i.A. nur an einer einzigen, stark lokalisierten Stelle im Universum wesentlich von Null verschiedenen Wert.
- Dies impliziert, dass auch n u r dort eine irgendwie nennenswerte Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass dieses Paket von Wellen — das Wesen also, von dem wir sprechen — mit anderen Wellenpaketen so kollidiert, dass es zum Zeitpunkt dieser Kollision beobachtet und durch sie modifiziert wird.
Wichtige Folgerung aus all dem wäre dann auch, dass biologische Organismen, wirklich g e n a u betrachtet, kaum zueinander disjunkt sein können (aber auch das wissen wir ja schon: Wir brauchen da ja nur an uns selbst und an alle in unserem Körper lebenden Bakterien und/oder Viren zu denken, von einzelnen körpereigenen Zellen mal ganz abgesehen).
Wer Bruce Liptons Buch Intelligente Zellen gelesen hat, wird dann auch nicht mehr erstaunt darüber sein, dass jede Gemeinschaft biologischer Organismen — etwa die Gemeinschaft sämtlicher auf dieser Erde lebenden Menschen — ebenfalls biologischer Organismus im angenommenen Sinne ist. Kein Wunder also, dass die Evolution dieser speziellen Gemeinschaft durch die gleichen Naturgesetze getrieben wird, wie schon lange vor ihr (und natürlich auch jetzt noch) die Evolution großer biologischer Zellverbände ganz allgemein.
Beitrag 0-127
Wie Genomvergleich uns den Weg der Evolution zu zeigen in der Lage ist
Was Genom-Vergleich uns zeigt
Seitdem der Mensch gelernt hat, sein eigenes Genom — ja sogar das Genom aller Lebewesen — zu kartieren, lässt sich durch den Vergleich der Genome auch der lange Weg der Evolution recht gut nachverfolgen.
Darwin (der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte), hatte noch keine Möglichkeit, herauszufinden, über welchen Mechanismus Evolution durch Selektion möglich wird. Wir aber sehen heute, dass die Varianten, die er postulierte, durch natürlich auftretende Mutationen der DNA bewerkstelligt werden.
Die meisten Mutationen treten in unwichtigen Teilen des Genoms auf und haben daher wenig oder gar keine Auswirkung. Der Grund hierfür: Mutationen in den wichtigeren Teilen des Genoms sind i.A. schädigend und werden schnell aussortiert, da sie die Fähigkeit zur Reproduktion beeinträchtigen.
Zu seltenen Gelegenheiten aber tritt eine Mutation auf, die einen leichten selektiven Vorteil bedeutet. Diese neue "Schreibweise" der DNA wird dann eine geringfügig höherer Wahrscheinlichkeit haben, an die Nachkommen weiter gegeben zu werden. Über sehr lange Zeiträume hinweg kann sie sich dann in allen Mitgliedern der Spezies durchsetzen und schließlich zu größeren Veränderungen der einen oder anderen biologischen Funktion führen.
Genomvergleich führt zur Erkenntnis, dass jedes Paar von Arten einen gemeinsamen Vorfahren hat, beispielsweise der Mensch und die Maus, deren Genome heute mit besonders hoher Genauigkeit bestimmt sind:
Die der Spezies Mensch am nächsten verwandten Arten sind Schimpansen (gefolgt von Orang-Utan und Makake): Die Genome von Schimpanse und Mensch sind, von Junk DNA mal abgesehen, zu 96% gleich. Man lese dazu auch die Meldung: Nur der Mensch verfügt über ein spezielles Gen, das nach Meinung der Forscher dafür verantwortlich sein könnte, dass wir sprechen können. Es sorgt für die Produktion einer speziellen Nukleinsäure, der sogenannten microRNA miR-941.
In diesem Zusammenhang ist interessant:
Populationsgenetiker, die mit mathematischen Methoden die Geschichte von Tier, Pflanzen- und Bakterien-Populationen rekonstruieren, glauben durch Genomvergleich erkannt zu haben, dass sich alle heute lebenden Menschen auf eine gemeinsame Gruppe von Vorfahren zurückführen lassen, die aus nur etwa 10.000 Personen bestand und vor 100.000 bis 150.000 Jahren gelebt haben muss.
Dies passt zu fossilen Befunden, die zu zeigen scheinen, dass der Aufenthaltsort dieser unserer Vorfahren Ostafrika war.
Quelle: Francis S. Collins: Gott und die Gene (2006), S. 100-114.
Ganz erstaunlich ist auch, dass die Komplexität des Genoms stark unterschiedlicher Spezien keineswegs der Komplexität ihrer durch uns beobachtbaren typischen Eigenschaften entspricht. Hier einige Beispiele:
Seit 2016 denkt man Hinweise darauf zu haben, dass alles irdische Leben einen gemeinsamen Vorfahren hat.
Seitdem der Mensch gelernt hat, sein eigenes Genom — ja sogar das Genom aller Lebewesen — zu kartieren, lässt sich durch den Vergleich der Genome auch der lange Weg der Evolution recht gut nachverfolgen.
Darwin (der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte), hatte noch keine Möglichkeit, herauszufinden, über welchen Mechanismus Evolution durch Selektion möglich wird. Wir aber sehen heute, dass die Varianten, die er postulierte, durch natürlich auftretende Mutationen der DNA bewerkstelligt werden.
-
Sie treten schätzungsweise mit einer Rate von 1 : 100 Millionen Basenpaaren pro Generation auf.
Da jeder von uns zwei Genome zu je 3 Milliarden Basenpaaren hat — geerbt von Vater und Mutter — ergibt sich so, dass jeder von uns einzigartig wird durch etwa 60 Mutationen,
die bei seinen Eltern noch nicht vorhanden waren.
Die meisten Mutationen treten in unwichtigen Teilen des Genoms auf und haben daher wenig oder gar keine Auswirkung. Der Grund hierfür: Mutationen in den wichtigeren Teilen des Genoms sind i.A. schädigend und werden schnell aussortiert, da sie die Fähigkeit zur Reproduktion beeinträchtigen.
Zu seltenen Gelegenheiten aber tritt eine Mutation auf, die einen leichten selektiven Vorteil bedeutet. Diese neue "Schreibweise" der DNA wird dann eine geringfügig höherer Wahrscheinlichkeit haben, an die Nachkommen weiter gegeben zu werden. Über sehr lange Zeiträume hinweg kann sie sich dann in allen Mitgliedern der Spezies durchsetzen und schließlich zu größeren Veränderungen der einen oder anderen biologischen Funktion führen.
-
Sozusagen im Zeitraffer-Tempo kann man solche Evolution beobachten in Form schneller Variation krankheitserregender Viren, Bakterien und Parasiten, durch die es zu schneller Ausbreitung von Epidemien kommen kann.
So sind z.B. die schnellen evolutionären Veränderungen des HIV-Virus, der AIDS verursacht, zu einer großen Herausforderung für die Entwicklung wirksamer Impfstoffe geworden.
Genomvergleich führt zur Erkenntnis, dass jedes Paar von Arten einen gemeinsamen Vorfahren hat, beispielsweise der Mensch und die Maus, deren Genome heute mit besonders hoher Genauigkeit bestimmt sind:
- Ihr Inventar protein-kodierender Gene ist bemerkenswert ähnlich, und auch die Länge der beiden Genome unterscheidet sich nur wenig.
Auch die Ordnung der Gene — die Reihenfolge also, in der sie nacheinander auftreten — ist in wichtigen Abschnitter der DNA dieselbe, obgleich dazwischen durchaus mehr oder wenier
nicht-kodierender Gene — sog. Junk DNA, Folgen sog. ancient repetitive elements (AREs) — zu finden sein kann.
Sie entstammen "springenden Genen", die sich kopieren und an diversen anderen Stellen im Genom einfügen können, meistens ohne funktionelle Folgen.
Genome von Säugetieren sind übersät mit solchen AREs, rund 45% des menschlichen Genoms bestehen aus solchem gegentischen Strandgut.
Wenn man nun längere Abschnitte des Menschen- und Mausgenoms so ausrichtet, dass sich entsprechende Folgen kodierender Gene neben einander liegen, findet man häufig auch zwei identische AREs an etwa derselben Stelle, und weiß daher, dass sie als Mutation in einem gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Maus entstanden sein müssen.
Die der Spezies Mensch am nächsten verwandten Arten sind Schimpansen (gefolgt von Orang-Utan und Makake): Die Genome von Schimpanse und Mensch sind, von Junk DNA mal abgesehen, zu 96% gleich. Man lese dazu auch die Meldung: Nur der Mensch verfügt über ein spezielles Gen, das nach Meinung der Forscher dafür verantwortlich sein könnte, dass wir sprechen können. Es sorgt für die Produktion einer speziellen Nukleinsäure, der sogenannten microRNA miR-941.
Francis S. Collins (2006):
Neuerdings interessiert man sich sehr für das Gen FOXP2, welches die Sprachentwicklung zu beeinflussen scheint:
Die Geschichte von FOXP2 begann mit der Beobachtung einer Familie in England, deren Mitglieder über drei Generation starke Schwierigkeiten beim Sprechen hatten. Sie hatten Schwierigkeiten, Worte entsprechend grammatikalischen Regeln anzuordnen oder komplexe Satzstrukturen zu erfassen. Die Muskeln ihrer Münder, Gesichter und Kehlköpfe hatten zu kämpfen, sich so zu bewegen, dass bestimmte Laute hervorgebracht wurden.
Mit schier unglaublicher genetischer Spürarbeit fand man heraus, dass bei den betroffenen Mitgliedern dieser Familie nur ein einziger Buchstabe des DNA-Codes im FOXP2-Gen auf Chromosom 7 falsch war. Die Tatsache, dass ein so kleiner Fehler solch tiefgreifende Sprachschwächen verursacht, ansonsten aber keine Folgen hat, war erstaunlich.
Noch erstaunter aber war man, als sich zeigte, dass die Sequenz desselben FOXP2-Gens bemerkenswert stabil in allen Säugetieren vokommt. Die dramatische Ausnahme ist der Mensch, bei dem sich vor etwa 100.000 Jahren zwei bedeutsame Veränderungen in der kodierenden Region des Gens ereigneten. Man nimmt nun an, dass diese Veränderung in FOXP2 zur Sprachentwicklung beim Menschen beigetragen hat.
In diesem Zusammenhang ist interessant:
Populationsgenetiker, die mit mathematischen Methoden die Geschichte von Tier, Pflanzen- und Bakterien-Populationen rekonstruieren, glauben durch Genomvergleich erkannt zu haben, dass sich alle heute lebenden Menschen auf eine gemeinsame Gruppe von Vorfahren zurückführen lassen, die aus nur etwa 10.000 Personen bestand und vor 100.000 bis 150.000 Jahren gelebt haben muss.
Dies passt zu fossilen Befunden, die zu zeigen scheinen, dass der Aufenthaltsort dieser unserer Vorfahren Ostafrika war.
Ganz erstaunlich ist auch, dass die Komplexität des Genoms stark unterschiedlicher Spezien keineswegs der Komplexität ihrer durch uns beobachtbaren typischen Eigenschaften entspricht. Hier einige Beispiele:
- Das menschliche Genom besteht aus nur etwa 25.000 Genen.
- Schon ein Seeigel hat etwas mehr: ca. 26.000.
- Das Genom von Pflanzen kann sogar deutlich mehr haben. Reis z.B. verfügt über etwa 38.000 Gene.
Seit 2016 denkt man Hinweise darauf zu haben, dass alles irdische Leben einen gemeinsamen Vorfahren hat.
Beitrag 0-413
Unser Denken und Fühlen — wie es sich aus quantenphysikalischer Sicht heraus darstellt
Unser Denken und Fühlen
aus quantenphysikalischer Sicht heraus
Unser Gehirn ist ein quantenmechanisches System, welches für uns konstruiert, was wir unsere Realität nennen (z.B. Farben korresponierend zur Wellenlänge von Licht, das den Sehpurpur in unserem Auge erreicht, letztlich aber alle Bedeutung von Signalen, die unsere Sinnesorgane erreichen).
Rein alles, was wir als real erachten (= unsere Interpretation der uns erreichenden Signale) ist eine sich ständig — im Detail wenigstens — modifizierende Menge mit JA oder NEIN beantworteter Fragen. Jede Antwort darauf stellt genau ein Bit an Information dar und wird erzeugt durch einen Kollaps der Wellenfunktion, welche uns und insbesondere die Menge all unserer Neuronen, beschreibt: unseren Denkapparat.
Diese Bits aber sind, so scheint es jedenfalls, nicht irgendwo in unserem Gehirn gespeichert (wie man früher dachte), sondern bestimmen Form und Intensität elektromagnetischer Signale, deren Quelle unser Gehirn und unser Nervensystem sind.
Als extrem energieschwache — und daher als Wellen sehr großer Wellenlänge — werden nun aber fast alle der von unserem Gehirn erzeugten elektromagnetischen Wellen weit über unseren Schädel hinaus existieren, sich also mit Lichtgeschwindigkeit ausgehend von uns im gesamten Universum ausbreiten, bis sie sich — die einen fast sofort, die anderen erst in weiter Zukunft — dort durch Dekohärenz auflösen zu Signalen, die andere belebte oder unbelebte Materie auf quantenmechanischer Ebene, in sehr geringen Ausmaß also, hinsichtlich ihres Zustands abändern (genauer: sie verschmelzen dort mit einem Elektron eines Atoms jener Materie – so extrem gering also ist diese Auswirkung).
Umgekehrt können so auch Gedanken anderer Menschen oder Lebewesen das eine oder andere Atom in unserem Gehirn in einen Zustand versetzen, den es ohne jene Gedanken anderer nicht gegeben hätte.
Bisher ist Wissenschaft nicht in der Lage, solchen Einfluss auf unser Gehirn zu messen oder gar zu untersuchen. Vorhanden — ganz extrem schwach vorhanden — ist er aber auf jeden Fall, und es kann wohl auch nicht ausgeschlossen werden, dass in extrem seltenen Fällen solcher Einfluss dann doch eine Rolle spielt in dem Sinne, dass er uns — irgendwie, als nur flüchtiger Gedanke — bewusst wird.
Etwas häufiger werden solche Einflüsse ganz sicher auch unser unbewusstes Denken beeinflussen.
Nebenbei noch: Wenn auf die beschriebene Weise ein aus dem Gehirn eines Lebewesens A kommendes Photon den Zustand eines Atoms im Gehirn eines anderen Lebewesens modifiziert, wird das natürlich auch Quantenverschränkung zur Folge haben. Was sich daraus dann an Korrelation ergeben kann, ist noch weit weniger zu durchschauen.
aus quantenphysikalischer Sicht heraus
Unser Gehirn ist ein quantenmechanisches System, welches für uns konstruiert, was wir unsere Realität nennen (z.B. Farben korresponierend zur Wellenlänge von Licht, das den Sehpurpur in unserem Auge erreicht, letztlich aber alle Bedeutung von Signalen, die unsere Sinnesorgane erreichen).
Rein alles, was wir als real erachten (= unsere Interpretation der uns erreichenden Signale) ist eine sich ständig — im Detail wenigstens — modifizierende Menge mit JA oder NEIN beantworteter Fragen. Jede Antwort darauf stellt genau ein Bit an Information dar und wird erzeugt durch einen Kollaps der Wellenfunktion, welche uns und insbesondere die Menge all unserer Neuronen, beschreibt: unseren Denkapparat.
Diese Bits aber sind, so scheint es jedenfalls, nicht irgendwo in unserem Gehirn gespeichert (wie man früher dachte), sondern bestimmen Form und Intensität elektromagnetischer Signale, deren Quelle unser Gehirn und unser Nervensystem sind.
Als extrem energieschwache — und daher als Wellen sehr großer Wellenlänge — werden nun aber fast alle der von unserem Gehirn erzeugten elektromagnetischen Wellen weit über unseren Schädel hinaus existieren, sich also mit Lichtgeschwindigkeit ausgehend von uns im gesamten Universum ausbreiten, bis sie sich — die einen fast sofort, die anderen erst in weiter Zukunft — dort durch Dekohärenz auflösen zu Signalen, die andere belebte oder unbelebte Materie auf quantenmechanischer Ebene, in sehr geringen Ausmaß also, hinsichtlich ihres Zustands abändern (genauer: sie verschmelzen dort mit einem Elektron eines Atoms jener Materie – so extrem gering also ist diese Auswirkung).
Umgekehrt können so auch Gedanken anderer Menschen oder Lebewesen das eine oder andere Atom in unserem Gehirn in einen Zustand versetzen, den es ohne jene Gedanken anderer nicht gegeben hätte.
Bisher ist Wissenschaft nicht in der Lage, solchen Einfluss auf unser Gehirn zu messen oder gar zu untersuchen. Vorhanden — ganz extrem schwach vorhanden — ist er aber auf jeden Fall, und es kann wohl auch nicht ausgeschlossen werden, dass in extrem seltenen Fällen solcher Einfluss dann doch eine Rolle spielt in dem Sinne, dass er uns — irgendwie, als nur flüchtiger Gedanke — bewusst wird.
Nebenbei noch: Wenn auf die beschriebene Weise ein aus dem Gehirn eines Lebewesens A kommendes Photon den Zustand eines Atoms im Gehirn eines anderen Lebewesens modifiziert, wird das natürlich auch Quantenverschränkung zur Folge haben. Was sich daraus dann an Korrelation ergeben kann, ist noch weit weniger zu durchschauen.
Beitrag 0-105
Hin zu einer Wissenschaft des Bio-Engineerings
Erste Ansätze einer Wissenschaft
Bio-Engineering
Gegeben die Erkenntnis der Quantenphysik, dass alle Materie — und damit auch jedes Lebewesen — letztlich ein System mit einander wechselwirkender Pakete von Wellen mit Wirkpotential darstellt, würde man erwarten, dass sich dies früher oder später auch über Experimente wird nachweisen lassen.
Und tatsächlich ist dem so. Hier einige Beispiele:
Was sich hier andeutet fasst Ulrich Warnke zusammen in der Bemerkung: Wie es scheint, könnte die Erfüllung des Wunschtraumes von der Rückführung einer kranken in eine gesunde Zelle schon bald nur noch eine Frage der Bioingenieurskunst sein.
Bio-Engineering
Gegeben die Erkenntnis der Quantenphysik, dass alle Materie — und damit auch jedes Lebewesen — letztlich ein System mit einander wechselwirkender Pakete von Wellen mit Wirkpotential darstellt, würde man erwarten, dass sich dies früher oder später auch über Experimente wird nachweisen lassen.
Und tatsächlich ist dem so. Hier einige Beispiele:
- Heilung mittels Weitergabe durch die Natur elektromagnetisch kodierter Information:
Mitte der 90-er Jahre hat eine von Gariaev geführte Gruppe von Wissenschaftlern Ratten durch Injektion von Alloxan in die Betazellen der Bauchspeicheldrüse eine schwere Schädigung zugefügt:
Alloxan schädigt diejenigen Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin herstellen. Da nun kein Insulin mehr ausgeschüttet wurde, stieg der Blutzuckerspiegel der Ratten bis in pathologische Bereiche hinein.- Eine Gruppe der Ratten bekam keinerlei Behandlung und starb nach der Giftinjektion.
- Eine andere Gruppe wurde mit Radiowellen bestrahlt, auf die mit einem Laserstrahl sog. » Heilinformation « aufgeprägt worden war:
Sie war gesammelt worden durch Abscannen von elektromagnetischer Strahlung, die man empfangen hatte von den Bauchspeicheldrüsen neugeborener, vollkommen gesunder Ratten.
Die organeigene Strahlung der gesunden Bauchspeicheldrüsen war erfasst, addiert und verstärkt worden, und der Laserstrahl, der auf die erkrankten Ratten gerichtet wurde,
war mit der so gewonnenen Information moduliert.
- Ergebnis des Experiments: Der Blutzuckerspigel der krank gemachten, dann aber betrahlten Ratten sank rasch ab. Sie wurden wieder gesund.
Gariaev, Peter: Wave based Genome (in Russisch, 1994), Wave Genetic Code (in English, 1997), Moskau],
Gariaev et al.: The DNA-wave Computer (in: Journal of Non-Locality and Remote Mental Interactions 2(1), 2003
- Eine Gruppe der Ratten bekam keinerlei Behandlung und starb nach der Giftinjektion.
- Eine Arbeitsgruppe um R.O. Becker, USA, beschrieb Neubildung amputierter Extremitäten bei Lurchtieren infolge elektromagnetischer Potentialaufprägungen.
Aber schon vorher — in Anfang der 70-er Jahre — hatte man erstaunliche Differenzierungs- und Dedifferenzierungseffekte beim Applizieren von Potentialen an Pflanzen und Amphibien beobachtet.
Murray D.G. (1967): A Method for producing Cellular Dedifferentiation by means of very small Electric Currents (in: Transactions of the New York Academy of Science, Vol 29
Becker R.O., Murray G. (1970): The Electrical Control System Regulating Fracture Healing in Amphibians (in: Clinical Orthopaedics and Related Research, No. 73
- Ein erstes Patent für einen Apparat und eine Methode zur Informationsübertragung mit Hilfe von Potentialfeldern für medizinische Anwendungen wurde schon Anfang der 80-er Jahre vergeben:
Gellinas R.C. (1984): Apparatus and method for transfer of information by means of curl-free magnetic vector-potential fields, US Patent 4,432,098.
Was sich hier andeutet fasst Ulrich Warnke zusammen in der Bemerkung: Wie es scheint, könnte die Erfüllung des Wunschtraumes von der Rückführung einer kranken in eine gesunde Zelle schon bald nur noch eine Frage der Bioingenieurskunst sein.
Beitrag 0-391
Über den — noch wenig konkreten — Feldbegriff der Biologen
Zum Feldbegriff der Biologen
Der in der Entwicklungsbiologie verwendete Begriff des morphogenetischen Feldes ist nicht identisch mit den von Sheldrake angenommenen Feldern (die er ursprünglich ebenso nannte, heute aber genauer als morphische Felder bezeichnet).
Quelle: Fritz-Albert Popp: Rupert Sheldrake in der Diskussion —
Das Wagnis einer neuen Wissenschaft des Lebens (1997), S. 194-196.
Eine erste denkbare Möglichkeit, wie das morphische Feld physikalisch realiert sein könnte, hat (im selben Buch) Hans-Peter-Dürr beschrieben. Eine kurze Zusammenfassung seiner Argumentation findet sich auf Seite Wie plausibel ist Sheldrakes Idee morphischer Resonanz?
Auch noch interessant sind Popps Überlegungen zur Frage
Kann morphische Resonanz (wenn sie denn existieren sollte) direkt überhaupt beweisbar sein?
Der in der Entwicklungsbiologie verwendete Begriff des morphogenetischen Feldes ist nicht identisch mit den von Sheldrake angenommenen Feldern (die er ursprünglich ebenso nannte, heute aber genauer als morphische Felder bezeichnet).
Fritz-Albert Popp erklärt (1997):
Der Feldbegriff der Biologen hat sich unabhängig von dem der Physiker entwickelt. Wo Biologie von » Kraft « oder einem » Kraftfeld « spricht, ist damit i.A. keine physikalische Kraft gemeint.
Ganz sicher war das so bei Alexander Gurwitz, als er in seinen Notizen 1912 von einem » Kraftfeld « sprach.
Während in der Physik der Feldbegriff mathematisch formuliert ist — und daher mit großer Eleganz und höchster Perfektion die Stärke lokal wirkender Kräfte genau beschreiben kann —, sind biologische Felder etwas weit weniger Konkretes:
Der Feldgedanke der Biologen entstand aus dem Wunsch heraus, irgendwie ausdrückbar zu machen, was die spektakulären Experimente des deutschem Embryologen Hans Dries 1891 an Erkenntnissen gebracht hatten: Sie hatten die Annahme eines lokalen (unmittelbaren) kausalen Zusammenhangs zwischen der Struktur und der zeitlichen Entwicklung des Embryos widerlegt.Nachdem Driesch gezeigt hatte, dass sich ein ganzer Organismus aus nur einer Zelle entwickelt, wobei nach der ersten Zellteilung jede der Tochterzellen jeweils die Hälfte des späteren Organismus ausbildet, bewies er, dass überraschenderweise zwei vollständige Organismen aus den beiden Tochterzellen entstehen, wenn man sie zwingt, sich getrennt von einander zu entwickeln.
Damit war klar geworden: Es kann keine lokale, eindeutige Ursache-Wirkungs-Relation zwischen Struktur und deren zeitlicher Entwicklung geben.
Obgleich die Biologen auch heute noch darüber zerstritten sind, wie weit ihre Annahmen von der strengen Gültigkeit lokaler Wechselwirkung abweichen müssen — was sich auf räumliche ebenso wie zeitliche Lokalität bezieht —, herrscht Einigkeit darüber, dass das Konzept der morphogenetischen Felder das Geschehen im Prinzip beschreiben kann. (C.H. Weddington in Major Problems in Developmental Biology, Locke M. (Hrsg.), Academic Press 1966, S. 105-124).
Sheldrake ging — wie er ja auch selbst sagt — bei seiner Idee morphischer Resonanz vom schon existierenden Begriff des morphogenetischen Feldes aus, hat ihn aber erweitert um sog. » morphische Resonanz « und Nichtlokalität. Unter morphischen Feldern also muss man sie diese, erst durch ihn vorgeschlagene Variante des Feldes vorstellen:
Das morphische Feld erstreckt sich nicht-lokal über die gesamte Raumzeit, was bedeuten soll, dass es Ereignisse und formgebende Prozesse miteinander verknüpft, welche weder am gleichen Ort noch zu gleicher Zeit stattfinden. Die Stärke dieser » Wechselwirkung « wird als weitgehend unabhängig von der räumlichen Distanz der Ereignisse angenommen.
Die entscheidene Aussage über dieses Feld ist die Annahme, dass es darin eine auf die Formbildung Einfluss nehmende » morphische Resonanz « gäbe, womit gemeint ist, dass — sobald Materie irgendwo Form annahm — der Einfluss dieses Feldes zur Folge hat, dass sich häufiger als nur zufällig oft gleiche oder recht ähnliche Form auch anderswo bildet — in gewisser Weise autokatalytisch — und dass jede solche Wiederholung eines formbildenden Prozesses die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass er nochmals wiederholt wird.
Eine erste denkbare Möglichkeit, wie das morphische Feld physikalisch realiert sein könnte, hat (im selben Buch) Hans-Peter-Dürr beschrieben. Eine kurze Zusammenfassung seiner Argumentation findet sich auf Seite Wie plausibel ist Sheldrakes Idee morphischer Resonanz?
Auch noch interessant sind Popps Überlegungen zur Frage
Fritz-Albert Popp erklärt (1997, S. 202-203):
Es wird oft übersehen, dass eine große Vielfalt von Effekten, die sich in unserer Realität abspielen, messtechnisch nur schwer, wenn überhaupt erfassbar ist. Unser technisches Instrumentarium muss — bei allem Respekt vor seiner rasanten Entwicklung — im Vergleich zum Sensorium biologischer Lebewesen immer noch nur als » rudimentär « bezeichnet werden.
Ich selbst habe erlebt, wie noch in den 1970-er Jahren fast niemand an die Existenz der Biophotonen glauben wollte, und das nur deshalb, weil es keine alle überzeugende Nachweismöglichkeit gab.
Gurwitz, der als erster Anzeichen für die Existenz von Biolicht fand, wurde als » falscher Prophet « gebrandmarkt, und einen Italiener, der ähnliche Beobachtungen in den 1930-er Jahren gemacht hatte, wurde totgeschwiegen. An solchen Vorstellungen hat sich bis heute [1997] kaum was gändert — und das, obgleich es inzwischen weltweit etwa 40 Gruppen von Wissenschaftlern gibt, die täglich Biophotonen messen und nun zweifelsfrei wissen, dass biologische Systeme nur leben, solange sie Biophotonen emittieren.
Ähnliche Vorurteile könnten uns dazu veranlassen, Sheldrakes These als Spinnerei abzutun.
Man sollte aber bedenken, wie schwierig es sein muss, ein nicht lokales morphisches Feld nachzuweisen, das einfach nur die Wahrscheinlichkeit für die Koinzidenz bestimmter Ereignisse ein klein wenig erhöht.
Bereiche unserer » Realität « zu analysieren, die sich vielleicht noch lange der Nachweisbarkeit entziehen, aber dennoch Relevanz für unsere Entwicklung haben können, wird immer eine extrem schwierige Aufgabe sein. Offensichtlich aber ist, dass es solche Bereiche gibt.
So können sich beispielsweise schwächste Effekte, die immer in die gleiche Richtung wirken, über Jahrzehnte dramatisch aufschaukeln, ohne dass sie in den üblichen Zeiten der Laboruntersuchungen signifikant nachweisbar wären.
Es scheint mir daher wertvoller, die experimentelle Herausforderung der » morphischen Felder « anzunehmen, als sie ungeprüft abzutun.
Beitrag 0-457
Wie Homo sapiens lernt, die Evolution zu steuern
Experiments with Biological Intelligence
Please read:
Please read:
- 2019: Scientists Grew Tiny Human Brains and Hooked Them up to Robots —
/m
- 2019: Robots now have the tools to grow imitation, simplified human organs out of stem cells
Beitrag 1913-1
Wie Quantenmechanik und physikalische Chemie Darwin korrigieren
Auch Biologie ist nur Physik:
Wie Quantenmechanik und physikalische Chemie Darwin korrigieren
Nach Darwin bedeutet Evolution einfach nur zufällig eintretende Mutation gefolgt von natürlicher Auslese.
Heute wissen wir es genauer, denn unser Wissen über die allgemeinen Eigenschaften von Molekülen zeigt uns: Mutation ist letzlich der Übergang eines Quantensystems von Zustand A nach Zustand B, wobei dieser Zustandsübergang
ABER: Ob ein Quantensprung von Zustand A nach Zustand B oder C führt, wird durch den Paaren ( A, B) und ( A, C) zugeordnete Übergangswahrscheinlichkeiten geregelt, die sich aus den Wellenfunktionen aller möglichen Zustände ergeben.
Daraus folgt: Auch spontan eintretende Mutation ist in aller Regel nicht ohne Richtung. Dies führt zu einer Art von Auslese, die noch v o r dem Prozess der natürlichen Auslese stattfindet und jene daher gewissermaßen kanalisiert (sog. Quantenauslese — durch Biologen in der Evolutionstheorie recht lange ignoriert).
Motor der Evolution ist eben diese, ständig stattfindende, Quantenauslese.
Natürliche Auslese kann nur das bewerten, was ihr von der Quantenauslese zur Bewertung vorgelegt wird.
Versteht man Evolution als einen Prozess von Übergängen zwischen virtuellen Quantenzuständen, wie es die Quantenbiologie heute zu Recht tut, so ergibt sich:
Die sich entwickelnde Komplexität der Lebensformen entsteht keineswegs aus dem Nichts und auch nicht aus dem Chaos, sondern über Quantensprünge, die einer kosmischen Ordnung gehorchen, welche unabhängig davon existiert, ob oder wie oft Quanten und Quantensysteme ihnen mögliche Zustände tatsächlich annehmen.
Unter der Aktualisierung eines Quantenzustands versteht die physikalische Chemie das Springen des Quantensystems in eben diesen Zustand. So jedenfalls gebraucht Lothar Schäfer in seinem Buch "Versteckte Wirklichkeit" diesen Begriff. Er sagt:
In gewissem Sinne ist jeder von uns zu jedem Zeitpunkt Aktualisierung eines komplizierten Quantenzustandes, der schon lange vor unserer Geburt in der Quantenstruktur des Universums als Ordnungsmuster angelegt war, also existiert hat, und der auch lange nach unserem Tod als — dann wieder als nur virtueller (sprich: als gerade nicht durch ein Quantensystem angenommener) Zustand — weiter existieren wird.
Seine Aktualisierung durch uns
Wenn identische DNS-Moleküle aber nicht durch Kopieren entstehen, sondern durch wiederholtes Auftreten ein und desselben Quantenzustandes, erhält auch der Begriff der Abstammung eine etwas andere Bedeutung ...
grtgrt
Nach Darwin bedeutet Evolution einfach nur zufällig eintretende Mutation gefolgt von natürlicher Auslese.
Heute wissen wir es genauer, denn unser Wissen über die allgemeinen Eigenschaften von Molekülen zeigt uns: Mutation ist letzlich der Übergang eines Quantensystems von Zustand A nach Zustand B, wobei dieser Zustandsübergang
- entweder provoziert wurde (durch Zusammenstoß des Quantensystems mit einem Elementarteilchen, z.B. dem Zusammenstoß eines Lebewesens mit Röntgenstrahlung)
- oder auf einen spontanen, physikalisch zufälligen Quantensprung zurückzuführen ist.
ABER: Ob ein Quantensprung von Zustand A nach Zustand B oder C führt, wird durch den Paaren ( A, B) und ( A, C) zugeordnete Übergangswahrscheinlichkeiten geregelt, die sich aus den Wellenfunktionen aller möglichen Zustände ergeben.
Daraus folgt: Auch spontan eintretende Mutation ist in aller Regel nicht ohne Richtung. Dies führt zu einer Art von Auslese, die noch v o r dem Prozess der natürlichen Auslese stattfindet und jene daher gewissermaßen kanalisiert (sog. Quantenauslese — durch Biologen in der Evolutionstheorie recht lange ignoriert).
Natürliche Auslese kann nur das bewerten, was ihr von der Quantenauslese zur Bewertung vorgelegt wird.
Versteht man Evolution als einen Prozess von Übergängen zwischen virtuellen Quantenzuständen, wie es die Quantenbiologie heute zu Recht tut, so ergibt sich:
Die sich entwickelnde Komplexität der Lebensformen entsteht keineswegs aus dem Nichts und auch nicht aus dem Chaos, sondern über Quantensprünge, die einer kosmischen Ordnung gehorchen, welche unabhängig davon existiert, ob oder wie oft Quanten und Quantensysteme ihnen mögliche Zustände tatsächlich annehmen.
Unter der Aktualisierung eines Quantenzustands versteht die physikalische Chemie das Springen des Quantensystems in eben diesen Zustand. So jedenfalls gebraucht Lothar Schäfer in seinem Buch "Versteckte Wirklichkeit" diesen Begriff. Er sagt:
In gewissem Sinne ist jeder von uns zu jedem Zeitpunkt Aktualisierung eines komplizierten Quantenzustandes, der schon lange vor unserer Geburt in der Quantenstruktur des Universums als Ordnungsmuster angelegt war, also existiert hat, und der auch lange nach unserem Tod als — dann wieder als nur virtueller (sprich: als gerade nicht durch ein Quantensystem angenommener) Zustand — weiter existieren wird.
Seine Aktualisierung durch uns
- war möglich,
- war keineswegs notwendig,
- könnte sich aber wiederholen.
Wenn identische DNS-Moleküle aber nicht durch Kopieren entstehen, sondern durch wiederholtes Auftreten ein und desselben Quantenzustandes, erhält auch der Begriff der Abstammung eine etwas andere Bedeutung ...
grtgrt
Beitrag 1913-3
Vorauswahl durch quantenphysikalischen Zufall
Hallo Hans-m,
du scheinst mich gründlich missverstanden zu haben, denn ich behaupte keineswegs, dass jeder Zufall einzig und allein ein Ergebnis der Quantenphysik sei.
Meine Aussage ist: Der Weg hin zu einem neuen Lebewesen führt stets über eine sehr lange Kette von Zuständen, die a b w e c h s e l n d Ergebnis von physikalischem Zufall einerseits und Zufall im Sinne deiner Beispiele andererseits sind. Hierbei gilt:
Der quantenphysikalisch zufällige Schritt besteht im Kollabieren einer Wellenfunktion, sprich: im physikalisch zufälligen Reduzieren einer Menge möglicher Quantenzustände auf genau einen, der zu materieller Wirklichkeit W führt. Erst in dieser Wirklichkeit wirkt dann Zufall im Sinne deiner Beispiele.
Damit ist klar: Die Wirklichkeit, in der Zufall im Sinne deiner Beispiele wirkt, hätte — falls der vorangehende quantenphysikalische Zufall sich anders entschieden hätte — in eben dieser Form W gar nicht erst existiert (jedenfalls nicht hinsichtlich aller nur denkbaren Details).
Beste Grüße,
grtgrt
Hans-m aus 1913-2:Du machst es (in Beitrag 1913-2) komplizierter, als es ist.
Nach Deiner Aussage würde jedes zufällige Ereignis in der Quantenphysik seine Ursache finden.
Wenn Du eine Münze oder einen Würfel wirfst oder eine Roulettekugel ihr Feld findet, jeder "Zufall" wäre ein Ergebnis der Quantenphysik.
Hallo Hans-m,
du scheinst mich gründlich missverstanden zu haben, denn ich behaupte keineswegs, dass jeder Zufall einzig und allein ein Ergebnis der Quantenphysik sei.
Meine Aussage ist: Der Weg hin zu einem neuen Lebewesen führt stets über eine sehr lange Kette von Zuständen, die a b w e c h s e l n d Ergebnis von physikalischem Zufall einerseits und Zufall im Sinne deiner Beispiele andererseits sind. Hierbei gilt:
Der quantenphysikalisch zufällige Schritt besteht im Kollabieren einer Wellenfunktion, sprich: im physikalisch zufälligen Reduzieren einer Menge möglicher Quantenzustände auf genau einen, der zu materieller Wirklichkeit W führt. Erst in dieser Wirklichkeit wirkt dann Zufall im Sinne deiner Beispiele.
Damit ist klar: Die Wirklichkeit, in der Zufall im Sinne deiner Beispiele wirkt, hätte — falls der vorangehende quantenphysikalische Zufall sich anders entschieden hätte — in eben dieser Form W gar nicht erst existiert (jedenfalls nicht hinsichtlich aller nur denkbaren Details).
Beste Grüße,
grtgrt
Beitrag 1913-4
Wie auch chemische Gesetze die Evolution steuern
Wie in Beitrag 1913-3 gezeigt, wird Evolution durch zweierlei Zufall gesteuert:
Es ist wichtig, zu sehen, dass der hintergründige den vordergründigen kanalisiert, selbst aber auch kanalisiert wird durch die den Quanten zugeordneten Wahrscheinlichkeitswellen (durch das also, was Heisenberg als die der kosmischen Ordnung zugrundeliegenden " Tendenzen und Neigungen" nennt: siehe Beitrag 1915-5).
Da nun aber Wahrscheinlichkeiten nichts anderes als dimensionslose Zahlenverhältnisse sind, kommt man nicht umhin, feststellen zu müssen:
Wem das zu abstrakt ist, der sollte sich vor Augen führen, dass man — ausgehend von der Kenntnis der den Quanten zugeordneten Wahrscheinlichkeitswellen — die Struktur von Molekülen berechnen kann, letztlich also die Gesetze der Chemie.
Wie weit man da heute schon ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gilt:
Alle Moleküle, ob groß oder klein, sind Quantensysteme,
und so wirkt der quantenphysikalische Zufall hinein in sämtliche chemikalischen Vorgänge (!).
Das ist für die Evolution durchaus bedeutsam, wenn man sich vor Augen führt, dass quantenphysikalischer Zufall ja nur bezogen auf das Ergebnis je eines einzelnen Ereignisses absoluter Zufall zu sein scheint, statistisch gesehen aber, wie oben gerade erklärt, durchaus kanalisierend wirkt.
grtgrt
PS: Zur Terminologie, den Zufall betreffend, siehe Beitrag 1911-1.
Wie in Beitrag 1913-3 gezeigt, wird Evolution durch zweierlei Zufall gesteuert:
- durch einen vordergründig wirkenden (das ist der, von dem Darwin und die Beispiele aus Beitrag 1913-2 sprechen),
- daneben aber auch durch einen hintergründig wirkenden (das ist der quantenphysikalische).
Es ist wichtig, zu sehen, dass der hintergründige den vordergründigen kanalisiert, selbst aber auch kanalisiert wird durch die den Quanten zugeordneten Wahrscheinlichkeitswellen (durch das also, was Heisenberg als die der kosmischen Ordnung zugrundeliegenden " Tendenzen und Neigungen" nennt: siehe Beitrag 1915-5).
Da nun aber Wahrscheinlichkeiten nichts anderes als dimensionslose Zahlenverhältnisse sind, kommt man nicht umhin, feststellen zu müssen:
Zitat von Lothar Schäfer in: Versteckte Wirklichkeit, S. 47:An der Wurzel der Wirklichkeit finden wir Zahlenverhältnisse — nichtmaterielle Prinzipien, auf denen die Ordnung dieser Welt gegründet ist.
Die Grundlage der materiellen Welt ist somit nichtmateriell.
Wem das zu abstrakt ist, der sollte sich vor Augen führen, dass man — ausgehend von der Kenntnis der den Quanten zugeordneten Wahrscheinlichkeitswellen — die Struktur von Molekülen berechnen kann, letztlich also die Gesetze der Chemie.
Wie weit man da heute schon ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gilt:
- Schon 1998 gelang es, die Struktur von Cambrin zu berechnen. Cambrin ist mit etwa 640 Atomen ein eher kleines Protein-Molekül. Über noch größere Erfolge berichten Treppen et al., 2002, J. Phys. Chem. A. 106; 5498-5503.
- Insbesondere weiß man: Die Struktur selbst der größten röntgenographisch erforschten Proteine kann durch quanten-chemische Berechnungen ihrer Teile vorhergesagt werden (Jiang et al., 1995, Phys. Chem. 99:10521).
und so wirkt der quantenphysikalische Zufall hinein in sämtliche chemikalischen Vorgänge (!).
Das ist für die Evolution durchaus bedeutsam, wenn man sich vor Augen führt, dass quantenphysikalischer Zufall ja nur bezogen auf das Ergebnis je eines einzelnen Ereignisses absoluter Zufall zu sein scheint, statistisch gesehen aber, wie oben gerade erklärt, durchaus kanalisierend wirkt.
grtgrt
PS: Zur Terminologie, den Zufall betreffend, siehe Beitrag 1911-1.
Beitrag 1953-1
Wie konnte die Natur Leben hervorbringen?
Wie konnte die Natur Leben hervorbringen?
Hans-Peter-Dürr, argumentiert in seinen Reflexionen eines Quantenphysikers in etwa wie folgt:
Das Phänomen "Leben" sollte man nicht mehr als außerhalb der übrigen, sogenannten "unbelebten" Natur angesiedelt sehen.
Im Kontext der alten, auf Determinismus gegründeten Naturauffassung war das nahezu unmöglich, da der Mensch sich stets instinktiv dagegen gewehrt hat, nur als voll deterministisch arbeitendes Uhrwerk eingeordnet zu werden. Solcher Unverträglichkeit zu entgehen, zog man einen deutlichen Trennungsstrich zwischen dem Menschen und der übrigen Natur.
Diese "künstliche Trennung von Mensch und seiner Umwelt" habe viel mit der ökologischen Krise zu tun, die heute die menschliche Zivilisation existentiell bedroht. Es ist dies eine Behauptung, die ich (grtgrt) nicht so recht nachvollziehen kann. Sehr überzeugend aber finde ich alles weitere:
Die neue Physik, so Dürr,
Und dann kommt Dürr zu einem wirklich interessanten Punkt:
Eine vollständige statistische Ausmittelung jener Lebendigkeit erfolgt nur dann, wenn die ein Gesamtsystem bildenden Teile genügend unabhängig voneinander sind.
Da nun aber die Architektur jedes quantenmechanischen Systems nicht nur über die zwischen seinen Teilen wirksamen Grundkräfte bestimmt ist, sondern darüber hinaus durch Wahrscheinlichkeiten, die sich aus seiner Wellenfunktion ergeben, kann ein solches System nicht einfach nur als Summe seiner Teile verstanden werden — eine Tatsache, der man heute noch viel zu wenig Rechnung trägt:
Wer darüber nachdenkt, ob Leben auf diese Weise entstanden sein könnte, müsste meiner Meinung nach aber mindestens noch mit berücksichtigen, was mein Beitrag 1948-18 zu erklären versucht.
grtgrt
Hans-Peter-Dürr, argumentiert in seinen Reflexionen eines Quantenphysikers in etwa wie folgt:
Im Kontext der alten, auf Determinismus gegründeten Naturauffassung war das nahezu unmöglich, da der Mensch sich stets instinktiv dagegen gewehrt hat, nur als voll deterministisch arbeitendes Uhrwerk eingeordnet zu werden. Solcher Unverträglichkeit zu entgehen, zog man einen deutlichen Trennungsstrich zwischen dem Menschen und der übrigen Natur.
Diese "künstliche Trennung von Mensch und seiner Umwelt" habe viel mit der ökologischen Krise zu tun, die heute die menschliche Zivilisation existentiell bedroht. Es ist dies eine Behauptung, die ich (grtgrt) nicht so recht nachvollziehen kann. Sehr überzeugend aber finde ich alles weitere:
Die neue Physik, so Dürr,
- gestatte uns, die störende Fessel der strengen Determiniertheit abzustreifen oder wenigstens zu lockern,
- sei aber zur Begründung der vermuteten Willensfreiheit des Menschen wohl noch nicht ausreichend.
Und dann kommt Dürr zu einem wirklich interessanten Punkt:
Eine vollständige statistische Ausmittelung jener Lebendigkeit erfolgt nur dann, wenn die ein Gesamtsystem bildenden Teile genügend unabhängig voneinander sind.
Da nun aber die Architektur jedes quantenmechanischen Systems nicht nur über die zwischen seinen Teilen wirksamen Grundkräfte bestimmt ist, sondern darüber hinaus durch Wahrscheinlichkeiten, die sich aus seiner Wellenfunktion ergeben, kann ein solches System nicht einfach nur als Summe seiner Teile verstanden werden — eine Tatsache, der man heute noch viel zu wenig Rechnung trägt:
- Bei der Beschreibung von Molekülen nehmen Chemiker als selbstverständlich an, daß man dabei i.W. mit den groben Approximationen auskommt, welche nur die Intensitäten aber nicht die Phasenbeziehungen der Materiewellen der Elektronen berücksichtigen.
- Ähnlich die moderne Biologie: Sie — so argumentiert Dürr — sei von den Erfolgen der analytischen Betrachtung des Lebendigen so beeindruckt, daß sie sich heute immer weiter von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise entfernt. Sie tue dies in der Überzeugung, damit den Forderungen der exakten Naturwissenschaften am besten entgegenzukommem, übersehe aber, dass es hierfür einer geeigneten Ergänzung der heute dominanten rein analytischen Betrachtung bedürfte.
- Von welch zentraler Bedeutung eine solche Ergänzung sein kann, beweist die durch die moderne Chaostheorie aufgedeckte Tatsache, dass selbst schwächste Einwirkungen zu völlig verschiedenartiger Entwicklung führen können.
Wer darüber nachdenkt, ob Leben auf diese Weise entstanden sein könnte, müsste meiner Meinung nach aber mindestens noch mit berücksichtigen, was mein Beitrag 1948-18 zu erklären versucht.
grtgrt
Beitrag 1948-18
Zerfall und Evolution
Über Zerfall und Evolution
Sei S ein in sich abgeschlossenes, sich selbst überlassenes System, welches von einem Zustand z1 in einen Zustand z2 gerät.
Nehmen wir an, dieser Zustandsübergang sei atomar, seine Ursache also ein Elementarereignis (d.h. das spontane Entstehen eines Paares virtueller Elementarteilchen bzw. Kollision und Neuaufteilung von Elementarteilchen).
Nach Beitrag 1948-15 ist jeder Zustand z von S eine Mischung aus
Den Fall z1.O = 0 mal ausgenommen, gibt es stets sehr viel mehr Zustände des Systems, die ungeordneter sind als Zustand z1. Da zudem jedes Elementarereignis absolut zufälliges Ergebnis hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem weniger geordneten Zustand z2 führt größer als die, dass z2 geordneter als z1 ist.
Mit anderen Worten:
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Zustandsübergang Zerfall bewirkt, ist größer als die, dass er evolutionär wirkt (d.h. zu mehr Form bzw Ordnung führt).
Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Evolution zur Folge hat eben NICHT Null.
Sei S ein in sich abgeschlossenes, sich selbst überlassenes System, welches von einem Zustand z1 in einen Zustand z2 gerät.
Nehmen wir an, dieser Zustandsübergang sei atomar, seine Ursache also ein Elementarereignis (d.h. das spontane Entstehen eines Paares virtueller Elementarteilchen bzw. Kollision und Neuaufteilung von Elementarteilchen).
Nach Beitrag 1948-15 ist jeder Zustand z von S eine Mischung aus
- Ordnung einerseits (Synonym: z.O = Form = kybernetischer Informationsgehalt) und
- Unordnung andererseits (Synonym: z.U = Entropie = nachrichtentechnische Informationsdichte).
Den Fall z1.O = 0 mal ausgenommen, gibt es stets sehr viel mehr Zustände des Systems, die ungeordneter sind als Zustand z1. Da zudem jedes Elementarereignis absolut zufälliges Ergebnis hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem weniger geordneten Zustand z2 führt größer als die, dass z2 geordneter als z1 ist.
Mit anderen Worten:
Beitrag 1953-2
Läßt sich Biologie komplett auf Physik zurückführen?
Läßt sich Biologie komplett auf Physik zurückführen?
Diese Frage, so Dürrs Standpunkt, kann aufgrund unserer heutigen Einsichten weder klar mit JA, noch klar mit NEIN beantwortet werden.
Aber schon die Frage
Könnte Leben und Bewusstein allein auf Basis physikalischer Gesetze erklärbar sein?
würde Dürr eher mit JA beantworten. Und das obgleich er auch feststellt:
Lebewesen — Pflanzen, Tiere, Menschen — mit Maschinen zu verwechseln, wäre falsch, denn:
Diese Frage, so Dürrs Standpunkt, kann aufgrund unserer heutigen Einsichten weder klar mit JA, noch klar mit NEIN beantwortet werden.
Aber schon die Frage
würde Dürr eher mit JA beantworten. Und das obgleich er auch feststellt:
Lebewesen — Pflanzen, Tiere, Menschen — mit Maschinen zu verwechseln, wäre falsch, denn:
- Eine Maschine ist eine Menge gut in einander greifender Teile (sie passen zueinander, formen einander aber nicht).
- Ein Lebewesen aber ist wie ein Gedicht, das auf jeder Organisationsstufe — Buchstabe, Wort, Satz, Strophe — zusätzliche Dimensionen erschließt und schon vorhandenen neue Bedeutung geben kann.
Beitrag 0-23
Bestehen Lebewesen wirklich n u r aus Materie?
Bestehen Lebewesen wirklich n u r aus Materie?
Fragen wir spezieller: Wie wahrscheinlich ist es, dass jeder Mensch ausschließlich aus Materie besteht?
Materie ist nur e i n e Form, in der Energie auftreten kann. Legt nicht allein schon diese Tatsache die Frage nahe, ob nicht zumindestens d e n k e n d e Lebewesen aus mehr als nur Materie bestehen? Könnte es nicht sehr gut sein, dass z.B. jeder Mensch in seiner physischen Existenz aus Teilen besteht, die nicht in Form von Materie vorliegende Energie sind?
Die meisten Menschen sterben in einem Alter, das weit höher ist als das Alter jeder einzelnen Zelle, aus der sie kurz vor ihrem Tode (auf Materie reduziert) bestehen: Ihr Körper — das weiß man heute — ist einem Anzug vergleichbar, der sich abnützt und laufend dort durch neues Gewebe ersetzt wird, wo altes sich verschlissen hat. Damit aber kann doch ganz offensichtlich kein materieller Teil eines Menschen — auch nicht sein Gehirn — mit ihm selbst identifiziert werden. Wenn sein Gehirn aber nur Schnittstelle zwischen seinem materiellen und seinem NICHT materiellen Teil ist, stellen sich zwei überaus relevante Fragen:
Wie der Placebo-Effekt — und die Tatsache, dass es ihn wirklich gibt — sehr deutlich zeigt, kann der nichtmaterielle Teil des Menschen den materiellen Teil nicht nur steuern, sondern in seiner Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen.
Anders ausgedrückt: Der nicht in Form von Materie vorliegende Teil des Menschen kann den Körper des Menschen (d.h. seinen in Form von Materie vorliegenden Teil) wenigstens so weit mit gestalten, als dass er Druck aufbauen kann, der mitbestimmend dafür ist, in welche Richtung jener Körper sich entwickelt. Interessant ist, dass dieser Druck wohl auch auf Körper anderer Individuen einwirken kann:
Fragen wir spezieller: Wie wahrscheinlich ist es, dass jeder Mensch ausschließlich aus Materie besteht?
Materie ist nur e i n e Form, in der Energie auftreten kann. Legt nicht allein schon diese Tatsache die Frage nahe, ob nicht zumindestens d e n k e n d e Lebewesen aus mehr als nur Materie bestehen? Könnte es nicht sehr gut sein, dass z.B. jeder Mensch in seiner physischen Existenz aus Teilen besteht, die nicht in Form von Materie vorliegende Energie sind?
Die meisten Menschen sterben in einem Alter, das weit höher ist als das Alter jeder einzelnen Zelle, aus der sie kurz vor ihrem Tode (auf Materie reduziert) bestehen: Ihr Körper — das weiß man heute — ist einem Anzug vergleichbar, der sich abnützt und laufend dort durch neues Gewebe ersetzt wird, wo altes sich verschlissen hat. Damit aber kann doch ganz offensichtlich kein materieller Teil eines Menschen — auch nicht sein Gehirn — mit ihm selbst identifiziert werden. Wenn sein Gehirn aber nur Schnittstelle zwischen seinem materiellen und seinem NICHT materiellen Teil ist, stellen sich zwei überaus relevante Fragen:
- Kann die Lebensdauer seines nicht-materiellen Teiles (seines "Geistes" also) größer sein als die seines Körpers?
- Und wie könnte Physik seinen nicht-materiellen Teil modellieren (unter der Annahme, dass er vollständig aus Energie besteht und somit auch nur Paket von Wellen ist, die sich ständig auf- und abbauendes Kraftpotential darstellen)?
Wie der Placebo-Effekt — und die Tatsache, dass es ihn wirklich gibt — sehr deutlich zeigt, kann der nichtmaterielle Teil des Menschen den materiellen Teil nicht nur steuern, sondern in seiner Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen.
Anders ausgedrückt: Der nicht in Form von Materie vorliegende Teil des Menschen kann den Körper des Menschen (d.h. seinen in Form von Materie vorliegenden Teil) wenigstens so weit mit gestalten, als dass er Druck aufbauen kann, der mitbestimmend dafür ist, in welche Richtung jener Körper sich entwickelt. Interessant ist, dass dieser Druck wohl auch auf Körper anderer Individuen einwirken kann:
-
Im Jahre 1952 machte ein junger britischer Arzt — Albert Mason — einen Fehler, der ihm zu kurzer Berühmtheit verhalf:
Mason behandelte einen 16-jährigen Jungen gegen sein Warzen mit Hypnose (da Mason und auch andere Ärzte damit schon öfters Erfolg hatten). Der vorliegende Fall war ein ganz besonders schwerer:
Die lederne Haut des Buben erinnerte an die eines Elefanten, nicht an die eines Menschen.
Während der Junge in einer hypnotischen Trance war, erzählte im Mason, die Haut auf seinem Arm werde heilen, so dass er dort bald rosarote, ganz normale Haut haben werde.
Und tatsächlich, als der Junge eine Woche später wieder kam, sah der Arm zu Masons Freude sehr gesund aus. Doch als Mason den Jungen zu einem Chirurgen mitnahm,
der zuvor erfolglos versucht hatte, dem Jungen zu helfen, erfuhr Mason, dass er eine Fehldiagnose gestellt hatte:
Der Chirurg, äußerst erstaunt über die nun gesunde Haut, teilte Mason mit, der Junge litte nicht an Warzen, sondern stattdessen an einer unheilbaren Erbkrankheit (an Ichthyose,
einer angeborenen Verhornstörung der Haut). Durch die Kraft des Geistes hatten Mason und sein Patient etwas erreicht, das zu jener Zeit als absolut unmöglich galt.
Mason setzte die Hypnose-Sitzungen fort und zum allgemeinen Erstaunen wurde die gesamte Haut des Jungen allmählich gesund und rosa (gesunde Haut hatte er vorher nur auf seiner Brust gehabt).
Als Mason im British Medical Journal über seine so erfolgreiche Behandlung der Ichthyose veröffentlichte [Mason, 1952], gab es eine Sensation: Die Medien stürzten sich auf ihn, und zahlreiche Patienten mit dieser bis dahin unheilbaren Krankheit baten ihn um Hilfe. Doch es zeigte sich, dass die Hypnose nicht das Wundermittel war, auf das sie gehofft hatten: Mason arbeitete mit einigen dieser Patienten, doch es gelang ihm nie mehr, ähnliche Ergebnisse zu erzielen wie mit dem Jungen. Mason selbst schrieb dieses Versagen seiner eignenen inneren Einstellung zu. Er konnte nicht wieder zu der unbefangenen Haltung zurückfinden, in der er nach seiner festen Überzeugung » einen schweren Fall von Warzen « behandelt hatte. Er war sich jetzt vollkommen bewusst, dass er etwas behandelte, was alle anerkannten Mediziner als eine angeborene, unheilbare Krankheit betrachteten. Er tat zunächst so, als sei er davon unbeeindruckt, doch später (2003) erzählte er in einem Interview im Discovery Channel, dass er diese Leichtigkeit nur vorgetäuscht habe.
Die interessante Frage, die sich nun stellt, ist: Wie konnte es kommen, dass in diesem Fall der menschliche Geist stärker war als genetische Programmierung? Und wie konnte Masons innere Einstellung zum Heilungsversuch dessen Ergebnis beeinflussen?
[ Mason, 1952 ]: A Case of Congenital Ichthyosiform Erythrodermia of Brocq Treated by Hypnosis. British Medical Journal 30: 442-443
Beitrag 0-336
Warum Biophotonik nichts Esoterisches ist
Was – und wie seriös – ist Biophotonik?
Biophotonik ist ein Zweig der Biophysik,
Gurwitsch hat die Anerkennung seiner Entdeckung durch Fachkollegen nicht mehr erlebt, erst Popp hat ihr zum Durchbruch verholfen (obgleich auch seine Hochschulkarriere dadurch ein Ende fand).
Wie im Nachhinein bekannt wurde, ist auch italienischen Physikern in den 1950-er und 1960-er Jahren dieses Licht — das man heute Biophotonen nennt, schon aufgefallen.
Der erste Physiker, der in Deutschland (1976) Biophotonen zweifelsfrei nachweisen konnte, war Bernhard Ruth, der damals bei Popp promoviert hat. Noch zur Jahrtausendwende gehörte seine Apparatur zu den empfindlichsten, zuverlässigsten und zeitlich stabilsten Photonenmessgeräten, die bis dahin gebaut worden waren.
Da Biolicht nun also zweifelsfrei nachweisbar geworden war, wurde es schließlich doch noch Forschungsgegenstand auch anderer Wissenschaftler. Ende der 1990-er Jahre gab es dazu weltweit schon etwa 30 Forschungsgruppen. Allein an der Tohoku-Universität in Japan wurden zwischen 1994 und 1999 gut 100 Mio Dollar für Biophotonenforschung eingesetzt.
Die Intensität des von Biomasse abgestrahlten Lichts reicht von einigen wenigen bis hin zu einigen tausend Photonen pro Sekunde und Quadratzentimeter Oberfläche des lebenden Systems.
Neben der Grundlagenforschung in der Biophysik spielt die Beobachtung der Biophotonen heute schon in mehreren Bereichen eine wichtige Rolle, z.B.
Welch interessante Ergebnisse Untersuchungen solcher Art erbringen können, zeigt folgendes Beispiel:
Noch viel mehr solch interessante Fakten sind skizziert in Popp: Die Botschaft der Nahrung (1999). Er schreibt dort u.A.:
VORSICHT aber: Leider gibt es viele Esoteriker, die das Thema Biophotonik als Rechtfertigung ihrer skurrilen Ideen missbrauchen. Man muss gelegentlich schon sehr genau hinhören, um zu sehen, wer da streng wissenschaftlich oder doch eher nur wie ein Esoteriker argumentiert.
Einer, vor dessen Aussagen ich — jetzt mal ganz unabhängig von Biophotonik — explizit warnen möchte, ist Ulrich Warnke. Was er so von sich gibt, scheint mir wirklich nur Pseudowissenschaft zu sein. Die Quantenphysik jedenfalls hat er nicht wirklich verstanden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er bis März 2010 Akademischer Oberrat an der Universität Saarbrücken war.
Wer dagegen Popp verdächtigt, nicht wissenschaftlich genug vorzugehen, der hat nicht verstanden, dass Popp nichts anders macht, als zu untersuchen, wie sich aus der Lichtspeicherfähigkeit von Biomasse auf die Qualität jener Biomasse schließen lässt.
Wie es zur Aussendung von Biophotonen kommt, ist bislang ungeklärt:
Biophotonik ist ein Zweig der Biophysik,
- der sich erst unter starken Geburtswehen etablieren konnte,
- heute aber weltweit anerkannt ist.
- Es begann damit, dass — unabhängig voneinander — zwei zunächst anerkannte Wissenschaftler (erst der Russe Alexander Gurwitsch, später dann der Deutsche Fritz-Albert Popp) entdeckt hatten, dass Biomasse Licht speichert und umso intensiver auch abstrahlt, je frischer und je wertvoller sie als Lebensmittel noch ist.
Gurwitsch hat die Anerkennung seiner Entdeckung durch Fachkollegen nicht mehr erlebt, erst Popp hat ihr zum Durchbruch verholfen (obgleich auch seine Hochschulkarriere dadurch ein Ende fand).
Wie im Nachhinein bekannt wurde, ist auch italienischen Physikern in den 1950-er und 1960-er Jahren dieses Licht — das man heute Biophotonen nennt, schon aufgefallen.
Der erste Physiker, der in Deutschland (1976) Biophotonen zweifelsfrei nachweisen konnte, war Bernhard Ruth, der damals bei Popp promoviert hat. Noch zur Jahrtausendwende gehörte seine Apparatur zu den empfindlichsten, zuverlässigsten und zeitlich stabilsten Photonenmessgeräten, die bis dahin gebaut worden waren.
Da Biolicht nun also zweifelsfrei nachweisbar geworden war, wurde es schließlich doch noch Forschungsgegenstand auch anderer Wissenschaftler. Ende der 1990-er Jahre gab es dazu weltweit schon etwa 30 Forschungsgruppen. Allein an der Tohoku-Universität in Japan wurden zwischen 1994 und 1999 gut 100 Mio Dollar für Biophotonenforschung eingesetzt.
Die Intensität des von Biomasse abgestrahlten Lichts reicht von einigen wenigen bis hin zu einigen tausend Photonen pro Sekunde und Quadratzentimeter Oberfläche des lebenden Systems.
Neben der Grundlagenforschung in der Biophysik spielt die Beobachtung der Biophotonen heute schon in mehreren Bereichen eine wichtige Rolle, z.B.
- wenn man die Unterschiede zwischen normalen Zellen und Tumorzellen studieren möchte,
- oder Lebensmittel auf Frische und Qualität zu untersuchen wünscht.
- So hat sich z.B. herausgestellt, dass Eier gesunder Hühner signifikant mehr Biophotonen abgeben als Eier erkrankter Hühner.
Welch interessante Ergebnisse Untersuchungen solcher Art erbringen können, zeigt folgendes Beispiel:
-
Man dachte zunächst, dass ein unterschiedlicher Gehalt an Lecithin die unterschiedliche Lichtemission von Batterie- und Freilandeiern auslösen würde, erlebte dann aber eine Überraschung:
Die Beimengung der gleichen Menge von Lecithin, die im Dotter ohnehin schon vorhanden ist, erhöht die Lichtintensität nicht etwa um das Doppelte, sondern erstaunlicherweise um bis das 10-fache.
Unabweisbare Schlußfolgerung scheint zu sein: Das das natürlich im Ei vorhandene Lecithin bei weitem nicht die gleiche Leuchtreaktion zeigt, wie das zugemischte, lann Lecithin im Ei mit Sicherheit nicht als bloße Beimengung vorliegen:
Es muss im Dotter in spezifischer Weise eingebunden sein, so dass es im Lichttest kaum noch reagiert.
- In Freilandeiern sind keineswegs größere Lecithinmengen vorhanden sind als in Eiern der in Batterien gehaltenen Hühner — nicht einmal wenige Prozent mehr.
- Lecithinmoleküle erhöhen durch ihren natürlichen Einbau in den Dotter seine Lichtspeicherfähigkeit infolge eines bedeutsamen Synergieeffekts, der — wie in einer Gesellschaft — die Wechselwirkung der einzelnen Partner begünstigt.
Kein Zweifel: Der Photonentest spiegelt nicht nur Inhaltsstoffe wider, sondern auch Struktur und innere Ordnung des Lebensmittels.
Insbesondere haben jene Test gezeigt:
Noch viel mehr solch interessante Fakten sind skizziert in Popp: Die Botschaft der Nahrung (1999). Er schreibt dort u.A.:
-
Wir sind primär nicht Kalorienfresser, Fleischfresser, Vegetarier oder Allesfresser, sondern im Grunde genommen Ordungsräuber und Lichtsäuger.
So manch einer mag noch Zweifel daran hegen, dass wir uns tatsächlich von Licht ernähren. Bei Pflanzen aber ist das unbestreitbar so. Sie beziehen per Photosynthese ihre Energie direkt von der Sonne. Photonen verschweißen die überall vorhandenen Kohlendioxid- und Wassermoleküle zu Glukosepäckchen. Sie schließen sich in diese Zuckerdepots selbst ein und stehen als Lebensmittelquelle jedem höheren Lebewesen zur Verfügung.
In Tieren und Menschen — die ja direkt oder indirekt von Pflanzen leben — werden die Zuckermoleküle wieder aufgebrochen in Kohlendioxid und Wasser. Das Kohlendioxid wird über die Lunge, das Wasser über die Haut oder mit dem Urin ausgeschieden. Im Organismus übrig bleibt die Sonnenenergie, die das Lebewesen auf bisher nicht verstandene Weise antreibt, versorgt und — nach Schrödinger — auch ordnet [ Schrödinger: What is Life? (1945), Nachdruck: Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet (Piper 1999) ].
Wie könnte bewiesen werden, dass Licht die Qualität unserer Lebensmittel bestimmt? Ich stecke ein schönes, ausgewachsenes Blatt einer Topfpflanze in ein Lichtmessgerät und registriere den abklingenden Lichtstrom des Blattes. Dann wiederhole ich den gleichen Versuch mit einem schon welken Blatt der gleichen Pflanze. Ich sehe erhebliche Unterschiede: Nur das noch gesunde Blatt leuchtet lange und intensiv, bevor das gespeicherte Licht schließlich entweicht.
Hohe Qualität [ noch Ordnung bewahren zu können? ] — so lässt sich folgern — signalisiert sich durch hohe Lichtspeicherfähigkeit.
VORSICHT aber: Leider gibt es viele Esoteriker, die das Thema Biophotonik als Rechtfertigung ihrer skurrilen Ideen missbrauchen. Man muss gelegentlich schon sehr genau hinhören, um zu sehen, wer da streng wissenschaftlich oder doch eher nur wie ein Esoteriker argumentiert.
Einer, vor dessen Aussagen ich — jetzt mal ganz unabhängig von Biophotonik — explizit warnen möchte, ist Ulrich Warnke. Was er so von sich gibt, scheint mir wirklich nur Pseudowissenschaft zu sein. Die Quantenphysik jedenfalls hat er nicht wirklich verstanden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er bis März 2010 Akademischer Oberrat an der Universität Saarbrücken war.
Wer dagegen Popp verdächtigt, nicht wissenschaftlich genug vorzugehen, der hat nicht verstanden, dass Popp nichts anders macht, als zu untersuchen, wie sich aus der Lichtspeicherfähigkeit von Biomasse auf die Qualität jener Biomasse schließen lässt.
Wie es zur Aussendung von Biophotonen kommt, ist bislang ungeklärt:
- Die meisten Wissenschaftler halten sie für ein Nebenprodukt des Stoffwechsels, ähnlich wie metabolische Prozesse immer auch Abwärme produzieren, vergleichbar mit einem Verbrennungsmotor.
- Einzelne Forscher folgen mehr den Überlegungen von Gurwitsch und vermuten eine weiter gehende Bedeutung der Biophotonen.
- Popp denkt, dass die Lichtquanten von der DNA emittiert werden und Information enthalten, die andere DNA-Moleküle erreicht. Er weist auf die hochfrequenten Schwingungen hin, die in den Erbmolekülen stattfinden. Dabei verdrillt sich die spiralförmige DNA stärker und entspannt sich wieder und das mehrere Milliarden Mal pro Sekunde. Bei jeder dieser Schwingungen, so vermutet Popp, gebe die DNA ein Biophoton ab.
Beitrag 0-373
Wie sich unsere Erde — und Leben darauf — entwickelt haben
Geschichte der Erde
und des biologischen Lebens darauf
Kurz nachdem sie entstanden war — vor etwa 4,6 Mrd. Jahren — war unsere Erde ein gluflüssiger Ball mit Oberflächentemperaturen von bis zu 1200 Grad. Es gab da noch keine dauerhafte Atmosphäre, auch keine Ozeane. Die Strahlungsleistung der Sonne betrug nur etwa 70% ihrer heutigen Leistung, steigerte sich aber ständig bis in unsere Tage hinein.
Die Oberfläche der Erde kühlte sich langsam ab, und durch Abgasung entstand eine Atmosphäre. Sie war dicht und bestand zum größten Teil aus Kohlendioxid. Der damals noch extrem große Luftdruck glich die geringe Strahlungsleistung der jungen Sonne aus.
Nachdem sich die Oberfläche der Erde langsam abgekühlt hatte, konnten sich Erdkruste und erste Kontinente bilden, und schließlich begann ein etwa 1000 Jahre andauernder heftiger Regen, der Vertiefungen in der Erdkruste mit Ozeanen füllte. Zusätzlich wurde durch den nun einsetzenden Silikat-Karbonat-Kreislauf über Verwitterung und Kalkbildung sehr viel Kohlendioxid gebunden, in der kontinentalen Kruste abgelagert und dem atmosphärischen Recycling durch das Abtauchen vieler Teile der Erdkruste dauerhaft entzogen. Genauer:
Die eben beschriebene Phase der langsamen Abkühlung und des steten Kohlendioxidverbrauchs hielt bis vor etwa 2,5 Mrd. Jahren an — eben so lange, bis das Energiebudget der Erde einen kritischen Wert unterschritt und die erste große Eiszeit einsetzte. Sie dauerte 200 Mio. Jahre. (Zum Vergleich: Die erst viel später, vor etwa 170 Mio. Jahren, entstandene Spezies der Dinosaurier hat nur 135 Mio. Jahre existiert.)
Höchstwahrscheinlich handelte es sich nicht um eine durchgehende Eiszeit, sondern um mehrere, sich mit Warmzeiten abwechselnde Folge von Vereisungsphasen, während derer die bakterielle Produktion ebenso wie die chemische Verwitterung jeweils fast zum Stillstand kam und der Kohlendioxid-Wert der Atmosphäre wieder anstieg, so dass sie wärmer wurde und die Vereisung zum Stillstand brachte.
Dieses Wechselspiel wiederholte sich, bis die Sonneneinstrahlung, die inzwischen auf etwa 85% ihres heutigen Wertes angestiegen war, den Mangel an Kohlendioxid wieder ausglich.
Zu Ende jener großen Eiszeit traten erstmals Sedimente auf, die durch Schichtungen und Ablagerungen entstanden waren. Da sie auffällig rote Farbe hatten, nimmt man an, dass hier erstmals der Sauerstoff frei in der Atmosphäre vorkam, denn die rote Farbe der Sedimente ergibt sich schlicht und einfach durch Rost, d.h. durch Eisen, welches freiem Sauerstpff ausgesetzt ist.
Nun, vor etwa 2,5 Mio. Jahren, kam es zur nächsten großen Veränderung der Erde — wieder getrieben durch einzellige Lebewesen: Die Photosynthese war entstanden. Sie brachte nahzu dramatische Veränderungen mit sich.
Zunächst hielt damals vor allem der Stoffwechsel der Bakterien den Kohlendioxidanteil der Atmosphäre auf einem Vielfachen, etwa dem 20-fachen seines heutigen Wertes.
Der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre und im Oberflächenwasser der Ozeane stabilisierte sich auf etwa das 0,5 bis 1 Prozent seines heutigen Wertes und lies so vielfältige Stoffwechselwege — mit und ohne Sauerstoff — zu.
Zudem entstanden autotrophe Bakterien. Es sind dies solche, die auf organische Stoffe verzichten und anorganische Substanzen in körpereigene organische verwandeln können. Autotroph sind
Andererseits erschienen zum ersten Mal heterotrophe Organismen, die zum Aufbau ihrer Zellsubstanz und ihren Energiestoffwechsel organisches Substrat (= Kohlenstoffverbindungen) benötigen, was sie von der Existenz anderer Lebewesen abhängig macht. Heterotroph sind
Von nun an hieß es » Fressen und gefressen werden «. Die Bakterien entwickelten die Fähigkeit, sich zu vielzelligen, aber überwiegend undifferenzierten Aggregaten zusammenzuschließen.
Den entscheidenden Impuls für solche Höherentwicklung gab der nun möglich gewordene Einbau heterotropher und autothropher Bakterien als funktionale Einheiten in andere bakterien.
Durch solche Kooperation entstanden vor etwa 2,3 Mio Mrd. Jahren tierische und pflanzliche Eukaryoten mit deutlich stabileren Zellwandstrukturen als bei den bakterien. In der Folgezeit wurde durch die gesteigerte organische Produktion und Einbettung der zersetzungsresistenten Zellwandstrukturen in die Erdkruste der Atmosphäre erneut viel Kohlöendioxid entzogen. Noch verstärkt wurde dieser Trend durch die vor etwa 1,5 Mrd. Jahren auftauchenden mehrzelligen Organismen.
Vor etwa 900 bis 600 Mrd. Jahren vermehrten sich Bakterien und Plankton ganz enorm, und zudem begann das langsame Aufblühen der Algen. Die damit einhergehende Verringerung des atmosphärischen Kohlendioxids hat das Erdklima deutlich abgekühlt. Diese Eiszeitperiode — obgleich auch durch längere Warmzeiten unterbrochen — war vermutlich die gravierendste, die es je auf der Erde gab. Selbst niedrige Breiten bis fast hin zum Äquator waren betroffen. Sie endete vor 580 Mio Jahren.
Die Sonne strahlte damals schon mit 96% ihrer heutigen Kraft.
Der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre war damals nur noch 15 bis 20 Mal höher als heute.
Der Sauerstoffgehalt der Luft betrug schon einige Prozent und erlaubte so vielfältiges pflanzliches und tierisches Leben.
In diese Phase viel auch die Entwicklung der Hartteile — Knochen, Kalkschalen und pflanzliches Stützgewebe —, was in der Folgezeit zu einer starken Zunahme der Artenvielfalt und Individuengröße geführt hat.
Die nächste Vereisungsperiode war weniger gravierend und auf die Südpolregion beschränkt. Ursache für sie war wohl, das vor ca. 450 Mio Jahren Landpflanzen entstanden, die dann schnell das Festland eroberten. Zu dieser Zeit sank der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre auf nur noch etwa das 10-fache seines heutigen Wertes.
Schon bald nach der ersten Besiedlung des Festlandes durch Landpflanzen entstanden vor etw 400 Mio Jahren verholzte Gewächse, die bald Bäume und ganze Waldkolonien bildeten. Hierdurch wuchs die Biomasse nochmals stark an auf Kosten des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre.
Vor etwa 300 Mio Jahren näherte sich der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre seinem heutigen Wert. In diese Zeit fällt eine vierte Vereisungsperiode, die weite Teile des damaligen Südkontinents Gondwana betraf.
Durch Kollision der Kontinente formte sich schließlich der Superkontinent Pangäa.
Ab da kamen die plattentektonische Aktivität in der Erdringe für einge Zeit zum Stillstand, was den Kohlendioxid-Ausstoßm durch Vulkanismus verringerte ind den Treibhauseffekt abschwächte.
Vom ausgehenden Erdaltertum vor 270 Mio. Jahren bis vor etwa 35 Mio. Jahren gab es kaum noch Vereisungen. Eine wichtige Rolle beim Produzieren von Kohlendioxid durch Recycling des organischen Materials übernahm jetzt die damals entstehende Landtierwelt (Amphibien, Reptilien, Insekten, ...). Zudem wirkten sich auf das Klima aus
Solange Pangäa existierte (bis vor etwa 180 Mio Jahren) war das Klima extrem kontinental geprägt und die Kontinente von riesigen Wüstengebieten durchsetzt.
Nach dem Zerbrechen von Pangäa wurde das Klima warm und feucht bis in hohe Breiten hinauf. Diese Periode erreichte vor etwa 100 Mio Jahren ihren Höhepunkt mit Temperaturen von 14 bis 16 Grad Celsius im tiefen Ozean.
Damals setzten sich im Meereswasser die Phytoplankontypen durch (Kieselalgen, Grünalgen und Blaualgen) und auf dem Land die Blütenpflanzen.
Wie wir rekapitulierend feststellen, hat immer wieder der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre eine ganz wesentliche, stark steuernde Rolle gespielt. Wer heute über den Klimawandel nachdenkt (der diesen Gehalt massiv beeinflusst), sollte das nicht vergessen.
Quelle: Lesch & Kummer: Wie das Staunen ins Universum kam, Patmos-Verlag 2016, S. 170-176
und des biologischen Lebens darauf
Kurz nachdem sie entstanden war — vor etwa 4,6 Mrd. Jahren — war unsere Erde ein gluflüssiger Ball mit Oberflächentemperaturen von bis zu 1200 Grad. Es gab da noch keine dauerhafte Atmosphäre, auch keine Ozeane. Die Strahlungsleistung der Sonne betrug nur etwa 70% ihrer heutigen Leistung, steigerte sich aber ständig bis in unsere Tage hinein.
Die Oberfläche der Erde kühlte sich langsam ab, und durch Abgasung entstand eine Atmosphäre. Sie war dicht und bestand zum größten Teil aus Kohlendioxid. Der damals noch extrem große Luftdruck glich die geringe Strahlungsleistung der jungen Sonne aus.
Nachdem sich die Oberfläche der Erde langsam abgekühlt hatte, konnten sich Erdkruste und erste Kontinente bilden, und schließlich begann ein etwa 1000 Jahre andauernder heftiger Regen, der Vertiefungen in der Erdkruste mit Ozeanen füllte. Zusätzlich wurde durch den nun einsetzenden Silikat-Karbonat-Kreislauf über Verwitterung und Kalkbildung sehr viel Kohlendioxid gebunden, in der kontinentalen Kruste abgelagert und dem atmosphärischen Recycling durch das Abtauchen vieler Teile der Erdkruste dauerhaft entzogen. Genauer:
Harald Lesch (2016):
So wie das Wetter heute ist, kann es früher nicht gewesen sein. Die Uratmosphäre der Erde war ganz anders: In organischen Sedimenten und in Kalkstein ist der Anteil an Kohlenstoff etwa 100 000 Mal so hoch wie in der heutigen Atmosphäre. Das kann nur bedeuten, dass
- die sehr dichte und mit Wolken verhangene Uratmosphäre zu etwa 95% aus Kohlendioxid bestand,
- das bei einem Druck, der 80 bis 100 Mal höher war als der Luftdruck heute
- und deswegen die Entstehung des Lebens auf der Erde unter ganz anderen Bedingungen stattfand, als wir sie heute kennen:
Der hohe Konzentrationsgehalt an Kohlendioxid verringerte sich zunächst fast ausschließlich durch Verwitterung und den Aufbau von Kalkgestein.
Wegen der im Lauf der Erdgeschichte fortschreitenden Evolution trat dann aber die Biosphäre als treibender Motor für den Kohlenstoffkreislauf und die Klimaentwicklung immer stärker in den Vordergrund. Die Menge der Biomasse erhöhte sich gewaltig — vor allem im Zuge der Ausbildung der Waldsysteme.
Zusätzlich entwickelten die Primärproduzenten — Bakterien, Plankton und Landpflanzen — immer stabilere Zell- und Stützgewebe. Ihre Zersetzung hat sie nur zum Teil wieder in Kohlenstoff und Wasser zurückverwandelt. Ein eben so großer Teil blieb unzersetzbar und wurde langfristig im Erdboden gespeichert. Aus diesem organischen Material — Kerogen genannt — wurde über die Jahrmillionen hinweg fossiler Brennstoff.
Kerogen ist die häufigste Form von organischen Kohlenstoffen in der Erdkruste. Gelangt das von den Bakterien allmählich gebildete Kerogen tiefer in das Erdinnere, wird zunächst das darin enthaltene Wasser herausgepresst.
Wenn Temperaturen um 100 °C oder mehr herrschen und durch darüber liegende Sedimentschichten größerer Druck aus das Kerogen ausgeübt wird, setzen Stoffumwandlungsprozesse ein, die Erdöl und Erdgas freisetzen. Der größte Teil des Kohlenstoffs auf der Erde ist aber nicht in den fossilen Brennstoffen gebunden, sondern im Kalkstein (CaCO3) und im Schiefer.
Kerogen macht dennoch selten mehr als ein Prozent des Sediments aus, so dass pro Tonne Kerogen 100 Tonnen Gestein abzubauen und 99 Tonnen Asche zu entsorgen wären.
In der Urzeit blieben nur Spuren von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Nur ihretwegen ist der Treibhauseffekt nicht völlig zusammengebrochen. Wäre das geschehen, hätte eine dann anbrechende unumkehrbare Eiszeit unseren Planeten für immer zu einem Eisklumpen gemacht.
Die eben beschriebene Phase der langsamen Abkühlung und des steten Kohlendioxidverbrauchs hielt bis vor etwa 2,5 Mrd. Jahren an — eben so lange, bis das Energiebudget der Erde einen kritischen Wert unterschritt und die erste große Eiszeit einsetzte. Sie dauerte 200 Mio. Jahre. (Zum Vergleich: Die erst viel später, vor etwa 170 Mio. Jahren, entstandene Spezies der Dinosaurier hat nur 135 Mio. Jahre existiert.)
Höchstwahrscheinlich handelte es sich nicht um eine durchgehende Eiszeit, sondern um mehrere, sich mit Warmzeiten abwechselnde Folge von Vereisungsphasen, während derer die bakterielle Produktion ebenso wie die chemische Verwitterung jeweils fast zum Stillstand kam und der Kohlendioxid-Wert der Atmosphäre wieder anstieg, so dass sie wärmer wurde und die Vereisung zum Stillstand brachte.
Dieses Wechselspiel wiederholte sich, bis die Sonneneinstrahlung, die inzwischen auf etwa 85% ihres heutigen Wertes angestiegen war, den Mangel an Kohlendioxid wieder ausglich.
Zu Ende jener großen Eiszeit traten erstmals Sedimente auf, die durch Schichtungen und Ablagerungen entstanden waren. Da sie auffällig rote Farbe hatten, nimmt man an, dass hier erstmals der Sauerstoff frei in der Atmosphäre vorkam, denn die rote Farbe der Sedimente ergibt sich schlicht und einfach durch Rost, d.h. durch Eisen, welches freiem Sauerstpff ausgesetzt ist.
Nun, vor etwa 2,5 Mio. Jahren, kam es zur nächsten großen Veränderung der Erde — wieder getrieben durch einzellige Lebewesen: Die Photosynthese war entstanden. Sie brachte nahzu dramatische Veränderungen mit sich.
-
Die Photosynthese ist ein physiologischer Prozess zur Erzeugung von energiereichen Biomolekülen aus energieärmeren Stoffen mithilfe von Lichtenergie.
Er wird von Pflanzen, Algen und einigen Bakterien in Gang gesetz und getrieben.
Zunächst hielt damals vor allem der Stoffwechsel der Bakterien den Kohlendioxidanteil der Atmosphäre auf einem Vielfachen, etwa dem 20-fachen seines heutigen Wertes.
Der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre und im Oberflächenwasser der Ozeane stabilisierte sich auf etwa das 0,5 bis 1 Prozent seines heutigen Wertes und lies so vielfältige Stoffwechselwege — mit und ohne Sauerstoff — zu.
Zudem entstanden autotrophe Bakterien. Es sind dies solche, die auf organische Stoffe verzichten und anorganische Substanzen in körpereigene organische verwandeln können. Autotroph sind
- die grünen Pflanzen (sie ernähren sich von Mineralien und Photosysthese)
- und viele Zellen ohne Zellkern, die sog. Prokayoten.
Andererseits erschienen zum ersten Mal heterotrophe Organismen, die zum Aufbau ihrer Zellsubstanz und ihren Energiestoffwechsel organisches Substrat (= Kohlenstoffverbindungen) benötigen, was sie von der Existenz anderer Lebewesen abhängig macht. Heterotroph sind
- die meisten Bakterien,
- aber auch sämtliche die Pilze und Tiere.
Von nun an hieß es » Fressen und gefressen werden «. Die Bakterien entwickelten die Fähigkeit, sich zu vielzelligen, aber überwiegend undifferenzierten Aggregaten zusammenzuschließen.
Den entscheidenden Impuls für solche Höherentwicklung gab der nun möglich gewordene Einbau heterotropher und autothropher Bakterien als funktionale Einheiten in andere bakterien.
Durch solche Kooperation entstanden vor etwa 2,3 Mio Mrd. Jahren tierische und pflanzliche Eukaryoten mit deutlich stabileren Zellwandstrukturen als bei den bakterien. In der Folgezeit wurde durch die gesteigerte organische Produktion und Einbettung der zersetzungsresistenten Zellwandstrukturen in die Erdkruste der Atmosphäre erneut viel Kohlöendioxid entzogen. Noch verstärkt wurde dieser Trend durch die vor etwa 1,5 Mrd. Jahren auftauchenden mehrzelligen Organismen.
Vor etwa 900 bis 600 Mrd. Jahren vermehrten sich Bakterien und Plankton ganz enorm, und zudem begann das langsame Aufblühen der Algen. Die damit einhergehende Verringerung des atmosphärischen Kohlendioxids hat das Erdklima deutlich abgekühlt. Diese Eiszeitperiode — obgleich auch durch längere Warmzeiten unterbrochen — war vermutlich die gravierendste, die es je auf der Erde gab. Selbst niedrige Breiten bis fast hin zum Äquator waren betroffen. Sie endete vor 580 Mio Jahren.
Die Sonne strahlte damals schon mit 96% ihrer heutigen Kraft.
Der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre war damals nur noch 15 bis 20 Mal höher als heute.
Der Sauerstoffgehalt der Luft betrug schon einige Prozent und erlaubte so vielfältiges pflanzliches und tierisches Leben.
In diese Phase viel auch die Entwicklung der Hartteile — Knochen, Kalkschalen und pflanzliches Stützgewebe —, was in der Folgezeit zu einer starken Zunahme der Artenvielfalt und Individuengröße geführt hat.
Die nächste Vereisungsperiode war weniger gravierend und auf die Südpolregion beschränkt. Ursache für sie war wohl, das vor ca. 450 Mio Jahren Landpflanzen entstanden, die dann schnell das Festland eroberten. Zu dieser Zeit sank der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre auf nur noch etwa das 10-fache seines heutigen Wertes.
Schon bald nach der ersten Besiedlung des Festlandes durch Landpflanzen entstanden vor etw 400 Mio Jahren verholzte Gewächse, die bald Bäume und ganze Waldkolonien bildeten. Hierdurch wuchs die Biomasse nochmals stark an auf Kosten des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre.
Vor etwa 300 Mio Jahren näherte sich der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre seinem heutigen Wert. In diese Zeit fällt eine vierte Vereisungsperiode, die weite Teile des damaligen Südkontinents Gondwana betraf.
Durch Kollision der Kontinente formte sich schließlich der Superkontinent Pangäa.
Ab da kamen die plattentektonische Aktivität in der Erdringe für einge Zeit zum Stillstand, was den Kohlendioxid-Ausstoßm durch Vulkanismus verringerte ind den Treibhauseffekt abschwächte.
Vom ausgehenden Erdaltertum vor 270 Mio. Jahren bis vor etwa 35 Mio. Jahren gab es kaum noch Vereisungen. Eine wichtige Rolle beim Produzieren von Kohlendioxid durch Recycling des organischen Materials übernahm jetzt die damals entstehende Landtierwelt (Amphibien, Reptilien, Insekten, ...). Zudem wirkten sich auf das Klima aus
- die stärker gewordene Sonneneinstrahlung
- und auch die mit dem Zerbrechen von Pangäa einhergehende Erhöhung vulkanischer Aktivitäten, die Kohlendioxid ausstießen.
Solange Pangäa existierte (bis vor etwa 180 Mio Jahren) war das Klima extrem kontinental geprägt und die Kontinente von riesigen Wüstengebieten durchsetzt.
Nach dem Zerbrechen von Pangäa wurde das Klima warm und feucht bis in hohe Breiten hinauf. Diese Periode erreichte vor etwa 100 Mio Jahren ihren Höhepunkt mit Temperaturen von 14 bis 16 Grad Celsius im tiefen Ozean.
Damals setzten sich im Meereswasser die Phytoplankontypen durch (Kieselalgen, Grünalgen und Blaualgen) und auf dem Land die Blütenpflanzen.
Wie wir rekapitulierend feststellen, hat immer wieder der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre eine ganz wesentliche, stark steuernde Rolle gespielt. Wer heute über den Klimawandel nachdenkt (der diesen Gehalt massiv beeinflusst), sollte das nicht vergessen.
Beitrag 0-163
Was zum — sehr plötzlichen — Aussterben der Saurier geführt hat
Was (wahrscheinlich) das Aussterben der Saurier verursacht hat
Quelle: Mathias Bröckers: Das sogenannte Übernatürliche, Eichborn 1998, S. 250-251
Der Einschlag eines Asteroiden vor 65 Millionen Jahren gilt als gesichert, allerdings gab es zu dieser Zeit auch eine Phase intensiven Vulkanismus im Hochland von Dekkan (Indien). Die dabei freigesetzten Staubteilchen und Asche könnten zu einer starken Absorption des Sonnenlichtes geführt haben und damit zu einer globalen Abkühlung. Einige Hypothesen gehen sogar davon aus, dass dieser Vulkanismus mit dem Asteroideneinschlag in Verbindung stehen könnte, also praktisch durch ihn ausgelöst wurde.
Das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Mio Jahren ist nicht die einzige Episode von Massensterben in der Erdgeschichte. Innerhalb der vergangenen 500 Mio Jahre gab es mehrere Einschnitte, bei denen jeweils bis zu 80 Prozent allen tierischen und pflanzlichen Lebens vernichtet wurde.
Dass die Gattung » Mensch « die nächste dieser planetarischen Katastropen überleben wird, kann bezweifelt werden.
Mathias Bröckers, 1998 :
1980 erschien eine Arbeit des Nobelpreisträgers Louis Alvarez und seiner Mitarbeiter in der Zeitschrift » Science «, in der die bisher plausibelste Erklärung für das Aussterben der Saurier präsentiert wurde:
Die Autoren, darunter auch sein Sohn Walter Alvarez, gehen davon aus, dass am Ende der Kreidezeit — vor etwa 65 Mio Jahren — ein riesiger Astereoid auf der Erde einschlug: ein Himmelkörper von etwa 10 km Durchmesser, der
- mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/sec auf der Höhe von Yukatan (Mexiko) ins Meer stürzte
- und hierbei etwa das 5-Milliardenfache der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe freigesetzt haben könnte.
Nach Vorstellung der Autoren müssten sich die Staubwolken der Explosion auf der gesamten Erde verbreitet haben und müssten — anhand von Gesteinsablagerungen — selbst heute noch nachweisbar sein: vor allem Iridium, ein Material, das auf der Erde kaum vorkommt, aber Bestandteil von Astereoiden ist.
Und in der Tat: Eben diesen Nachweis von Iridium in den entsprechenden Gesteinsschichten an vielen Stellen der Erde konnten sie erbringen.
Der Einschlag eines Asteroiden vor 65 Millionen Jahren gilt als gesichert, allerdings gab es zu dieser Zeit auch eine Phase intensiven Vulkanismus im Hochland von Dekkan (Indien). Die dabei freigesetzten Staubteilchen und Asche könnten zu einer starken Absorption des Sonnenlichtes geführt haben und damit zu einer globalen Abkühlung. Einige Hypothesen gehen sogar davon aus, dass dieser Vulkanismus mit dem Asteroideneinschlag in Verbindung stehen könnte, also praktisch durch ihn ausgelöst wurde.
Das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Mio Jahren ist nicht die einzige Episode von Massensterben in der Erdgeschichte. Innerhalb der vergangenen 500 Mio Jahre gab es mehrere Einschnitte, bei denen jeweils bis zu 80 Prozent allen tierischen und pflanzlichen Lebens vernichtet wurde.
Dass die Gattung » Mensch « die nächste dieser planetarischen Katastropen überleben wird, kann bezweifelt werden.
tags: Zelle1gegreit Placebo1gegreit Leben1gegreit
 Nach oben
Nach oben